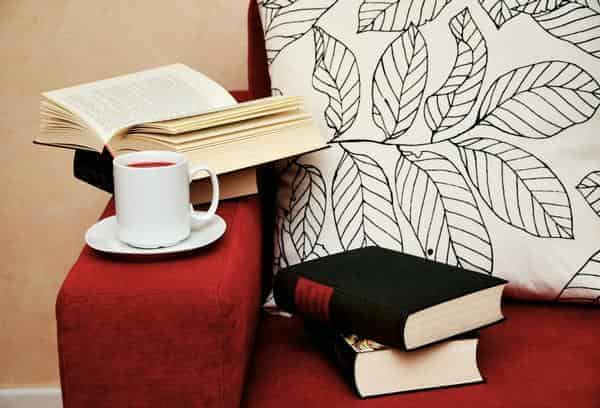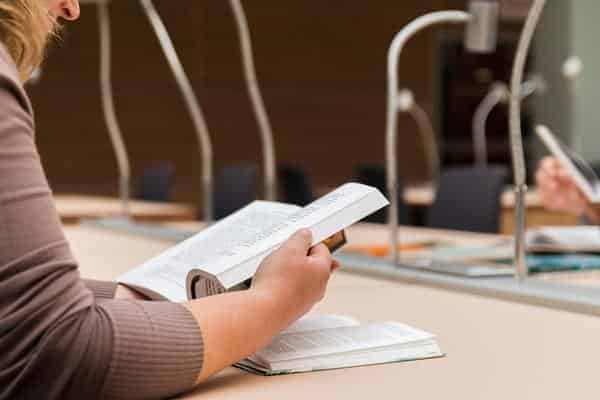„Das ist ein Hochseilakt“
Das Künstler-Ehepaar Sonja Ruf und Karl-Heinz Heydecke beschäftigt sich mit Sprache. Sie schreibt, er ist Lautpoet. Ein Portrait.
veröffentlicht am 11.01.2013 | Lesezeit: ca. 10 Min.
Bamberg. Ihre große Leidenschaft ist die Sprache. Die Faszination dafür begann früh. Bei Karl-Heinz Heydecke waren es vor allem die großen Buchstaben in der Zeitung, die ihn als Knirps begeisterten. Noch im Vorschulalter lernte er das Lesen. „Ich habe vor mich hinbuchstabiert. Es war eine tolle Welt, die sich plötzlich auftat. Ich verstand, was für Symbole das sind und habe mich dafür begeistert.“ Sonja Ruf erzählte als kleines Mädchen gerne Geschichten. Als sie schreiben konnte, notierte sie mit 8 Jahren als Berufswunsch in ihr Tagebuch: „Dichter, Regisseur oder Schlangenbeschwörerin“. Für die Sprache begeistern sich die beiden bis heute. Für das Künstler-Ehepaar ist Sprache Passion und Profession.
Bei Sonja Ruf in geschriebener Form, bei Karl-Heinz Heydecke in gesprochener Form. Seit 22 Jahren arbeitet die 45-Jährige als freie Schriftstellerin, ihr Mann ist als Lehr-Logopäde tätig und tritt als Lautpoet auf. Erst im Februar dieses Jahres hatte Karl-Heinz Heydecke eine Stelle als Logopädie-Dozent in Bamberg angetreten. Das Paar hatte sich darauf eingestellt, dauerhaft in der Stadt zu bleiben. Nach Jahrzehnten des „ziemlichen Nomandenlebens“, so der 55-Jährige, sahen sich die beiden angekommen. „Ich hätte mich hier gerne eingelebt“, sagt Sonja Ruf. Doch daraus wird nichts. An diesem Augustabend sitzen die beiden in ihrer kleinen Wohnung. Die Sachen sind gepackt. Am nächsten Tag wird es für Karl-Heinz Heydecke nach Saarbrücken gehen, wo er eine neue Stelle als Logopädie-Dozent an einer Fachschule für Gesundheitsberufe antritt. Seine Frau wird später nachkommen. Saarbrücken wird eine weitere Station für die beiden sein. „Ich denke die letzte“, sagt Karl-Heinz Heydecke. Für die beiden ist es der 23 Umzug, wie er sagt.
Zuvor hatten sie drei Jahre im unterfränkischen Bad Neustadt gelebt. Davor für zwei Jahre in Leipzig, wo Karl-Heinz Heydecke mit der Lautpoesie begann und 2008 seine bislang größten künstlerischen Erfolge in diesem Bereich feierte. Er trat gemeinsam mit Darstellern des Schauspiels Leipzig auf und präsentierte diese außergewöhnliche Gattung moderner Lyrik, zu deren bekanntesten Vertretern im 20. Jahrhundert die Autoren Hugo Ball, Kurt Schwitters und Erich Jandl gehörten. Eine Lyrik-Gattung, die auf sprachlichen Sinn verzichtet und ausschließlich den Klang des Gesprochenen in den Vordergrund stellt. In Leipzig trug Karl-Heinz Heydecke seine Texte vor, während die Darsteller seine Klänge auf der Bühne schauspielerisch umsetzten und tanzten. Die Resonanz beim Publikum war groß. „Ich habe gemerkt, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Da tut sich eine ganze Welt auf. Ich kann wirklich etwas machen, was sonst keiner macht. Zumindest nicht auf die Art.“ Während viele Lautpoeten „mit elektronischen Mitteln, mit Loops, mit Überblendungen und Verfremdungen“ arbeiteten, um herauszubekommen, „was so im sprachbildenden Organbezirk alles möglich ist, was man mit Klängen machen kann“, wie Karl-Heinz Heydecke sagt, setze er auf „die Unterströmung Musik“. Oder wie es seine Ehefrau formuliert: „Das ist für mich der große Unterschied zwischen dem, was Karl-Heinz macht und was andere Lautpoeten machen. Dass er seine Texte musikalisch organisiert, dass es Kompositionen sind, dass es sehr melodisch ist, sehr weich und warm und die Lautpoesie nicht auf inhaltlicher Ebene passiert. Bei anderen ist es manchmal sehr abgehakt und spröde.“ So interessiert den 55-Jährigen vor allem wie er Laute phonotaktisch kombinieren kann, also orientiert an jenen Regeln, mit denen Vokale und Konsonanten in der deutschen Sprache zusammengeführt werden, „und wie sich daraus neue Dinge ergeben, die musikalisch klingen.“ Auch, wenn Karl-Heinz Heydecke bei seinen Auftritten manchmal improvisiert, „ist im Grunde jedes Wort fest durchgeplant“. Das bedeutet: Er schreibt seine Lautkompositionen auf und rezitiert sie. „Da alles aufgeschrieben ist, kann ich mich auch versprechen“, sagt er. Ob es den Zuschauern auffalle, wisse er nicht. „Aber ich merke es schon, weil dann die Architektur kaputtgeht. Es stimmt dann etwas nicht.“ Die Reaktion der minutiös vorbereiteten und präsentierten lautpoetischen Werke fiel bislang immer gleich aus. „Weil es so seltsam ist, reagiert das Publikum mit Gelächter. Das soll es natürlich auch. Die Zuhörer amüsieren sich.“
Karl-Heinz Heydecke glaubt, dass das Publikum bei seinen Auftritten zwar zuerst überrascht, gleichzeitig aber wohlwollend ist, „weil es merkt, dass da jemand mit vollem Engagement arbeitet und es ernst meint“. Die Leute reagierten auf die Texte wie bei einem Artisten-Auftritt. „Es ist sehr viel Akrobatik dabei, man muss schon eine gewisse Virtuosität haben, um eine solche Reaktion zu erzeugen. Das Publikum hat zwar nichts verstanden, aber findet es ganz toll. Das ist ein Hochseilakt.“ Um den Zuhörern eine Orientierungshilfe zu bieten, erläutert Heydecke bei seinen Auftritten nach dem Eröffnungstext, was er da eigentlich mache, „was passiert, worum es geht und warum so eigenartige Wirkungen entstehen“. Die Lautpoesie feiere den Sprachklang, die befreite Artikulation, ohne dass zu viel störende Semantik, also Bedeutung, hineinkomme. In den Texten gebe es jedoch immer wieder kleine semantische Inseln für das Publikum, damit die Zuhörer „in dem ganzen Gewirr andocken“ und dem Text eine eigene Bedeutung geben könnten. Das kann zum Beispiel über den Titel eines Stücks geschehen oder über die Versform, in der die Laute präsentiert werden, beispielsweise in Form einer Ballade, eines Alexandriners oder eines Sonetts. Aber auch die Sprechweise ermögliche es den Zuschauern, den Lauten einen eigenen Sinn zu geben. „Ein Liebeslied wäre viel, viel weicher als beispielsweise eine verärgerte Stimme.“
Dass das Publikum die Texte selbst interpretiert, lässt sich auch schön an der „Standpauke des Trainers an die deutsche Nationalmannschaft“ nachvollziehen, die Heydecke 2010 auf Youtube veröffentlichte (abrufbar via QR-Code rechts). In dem zweieinhalbminütigen Clip schlüpft der Lautpoet in die Rolle des deutschen Fußballnationaltrainers, der seiner Mannschaft nach dem Spiel eine Standpauke hält. Was mit sinnvollen Sätzen beginnt, ändert sich immer mehr zu einer Mischung aus bedeutungsvollen Satzteilen, die mit bedeutungslosen Wortkreationen kombiniert wird. Beispielsweise, wenn von „ständig versemmelt ihr in der Plempe“ oder „wenn du Mitte gehst, dann musst du von hinten verbinsen“ die Rede ist. „Ich rede in dem Stück nur dummes Zeug“, sagt Heydecke. Seiner Ansicht nach funktioniert Lautpoesie vor allem über Pointenwitz. „Wortwitz gibt es nicht.“ Das Lachen bei lautpoetischen Texten hält er zudem für „ein Lachen, das nicht aus der Schadenfreude kommt“, da man über keine Person lachen könne. „Wahrscheinlich werden die Leute von den Möglichkeiten überrumpelt, die in der Sprache lauern und lachen deshalb.“ Während Lautpoesie bei Erwachsenen gut ankäme, Heydeckes längste Auftritte in Leipzig dauerten bis zu zwei Stunden, könnten Kinder damit nichts anfangen. „Manche Kinder kriegen sich zwar vor Lachen kaum noch ein, wenn tabuisierte Laute wie ein Lippenfurzen oder ‚Pipi Kack’ oder ähnliches zu hören sind, aber mit dem Auftritt an sich können Kinder nichts anfangen. Sie versuchen die Texte zu verstehen, was ich da mache und denken dann, dass der Onkel einen an der Waffel hat, weil das nicht wirklich sein kann.“
Inspirationen für seine lautpoetischen Texte findet Karl-Heinz-Heydecke im Alltag. Es können Alltagswörter oder Alltagsklänge sein, die eine Assoziation auslösen. „Das kein ein Graffiti sein, das ich sehe, aber auch ein Wort wie Kräuterbutterbaguette. Da ist ein Klang drin und dann geht es los.“ Um seine Eindrücke festzuhalten, hat der gebürtige Braunschweiger immer Papier, Stift und ein Diktiergerät dabei. Die besten Inspirationen für die Titel seiner Werke erhält er jedoch von seiner Frau. Alltägliche Aussagen wie „Ich fahr mal in die Tiefgarage, da wirst du gelbe Säcke sehen“, die Sonja Ruf unterwegs „aufschnappt und mitbringt“, dienen durchaus als Titelvorlage. Doch Sonja Ruf unterstützt ihren Mann nicht nur bei seiner Lautpoesie, sondern sie verwendet mittlerweile vereinzelt auch lautpoetische Konstruktionen in ihren Romanen, beispielsweise um ein Aufzuggeräusch zu verdeutlichen. Neun Bücher hat die 45-Jährige bereits veröffentlicht. Sie schreibt gegenwartsbezogene Literatur, wie sie sagt. Dementsprechend, „fließt eigene Erfahrung“ in ihre Romane, die sie aber verändere und verwische. Beim Schreibprozess sei sie sehr diszipliniert. Trotzdem: Die künstlerische Arbeit mache im besten Fall die Hälfte der Zeit aus. Der Rest bestehe aus Management und Akquise. Ihre Entscheidung als freie Schriftstellerin zu arbeiten hat Sonja Ruf bis heute nicht bereut. „Ich wollte es immer.“ Da die Fördermöglichkeiten durch Literaturstipendien mittlerweile jedoch gesunken sind, wird sie demnächst eine Ausbildung zur Kindererzieherin absolvieren. Einen Nachteil für ihre schriftstellerische Tätigkeit sieht sie darin nicht. „So ein Brotberuf macht künstlerisch unabhängig.
Das sehe ich auch bei Karl-Heinz. Er muss nicht das Publikum bedienen, er kann es, wenn er will und macht es total gern. Aber er ist nicht dazu gezwungen und kann seine Lautpoesie und freie improvisierte Musik machen.“ So komponiert Karl-Heinz Heydecke auch moderne Musik am Klavier. Zwei CDs hat er während seines Bamberg-Aufenthalt fertig gestellt. Den Wunsch sich mit Lautpoesie selbstständig zu machen, hat er nicht. Ende der 80er Jahre hatte er drei Jahre lang erfolgreich selbständig in einem Musik-Kabarett-Duo mitgewirkt. „Aber das hat gereicht“, sagt er. Irgendwann habe er es einfach nicht mehr ertragen, jeden Abend dasselbe Zeugs zu spielen. „Es darf sich nicht abnutzen und muss frisch bleiben“, sagt Sonja Ruf über die künstlerische Arbeit. Karl-Heinz Heydecke nickt. Ihren künstlerischen Tätigkeiten werden die beiden auch in Saarbrücken nachgehen. Und ab und zu werden sie auch noch nach Bad Neustadt zu Auftritten zurückkehren. Vielleicht ist dann auch ein Abstecher nach Bamberg drin.