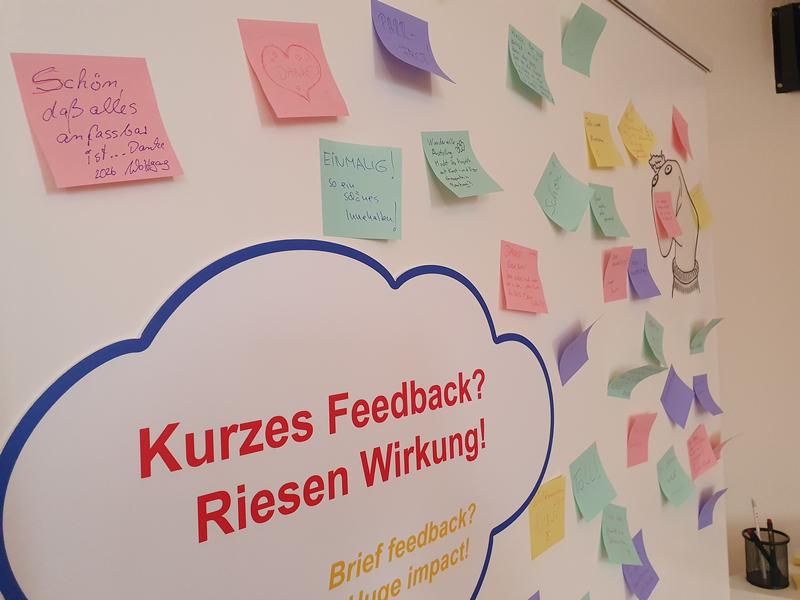Spitzenwerke der Abstrakten Kunst und Art Informel
Neue Sonderausstellung im Erfurter Angermuseum: Von Nay bis Altenbourg – Meisterwerke der deutschen Nachkriegsmoderne aus einer Privatsammlung
veröffentlicht am 28.07.2016 | Lesezeit: ca. 5 Min.
Was unter nationalsozialistischer Herrschaft als „Entartete Kunst“ galt, findet ihre eigentliche Bestimmung unter anderem im Begriff der Abstrakten Kunst. Er umreißt eine ganze Reihe an Kunstströmungen und Stilen des 20. Jahrhunderts, angefangen beim Kubismus über den Konstruktivismus bis hin zur Art Informel/Informellen Kunst.
Doch die vom Nazi-Regime gelenkte Kulturpolitik erschwerte die Arbeit zahlreicher Künstler wie Otto Dix, Ernst Barlach oder Ernst Ludwig Kirchner zunehmend und brachte ihr Schaffen beinahe zum Erliegen. Kunst wurde unter streng ideologischen Gesichtspunkten bewertet, vor allem die abstrakte Kunst bekam schnell den Stempel „Entartete Kunst“ aufgedrückt und wurde verboten. Die Räder der unerbittlichen Propagandamaschine liefen sich warm. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges brauchte es schließlich eine Weile, um sich von den Einschüchterungsversuchen der deutschen Machthaber und den Wirren des Krieges zu erholen. Nur allmählich nahmen die Künstler, wenn möglich, ihre Arbeit wieder auf, versuchten sich mittels Kunst von dem Erlebten zu befreien und neu zu emanzipieren. Besonders Farbe, Form und Materialität spielten in dieser Zeit eine immer wichtiger werdende Rolle.
Im Erfurter Angermuseum ist seit Juni eine neue Sonderausstellung zu besichtigen, die sich eingängig mit der deutschen Nachkriegsmoderne in Westdeutschland und der unangepassten Kunst der DDR jenseits des Sozialistischen Realismus beschäftigt. Ein anonymer Sammler, der eng mit der thüringischen Landeshauptstadt verbunden ist, jedoch noch vor dem Mauerbau nach Düsseldorf übersiedelte, stellt dem Museum und der Öffentlichkeit noch bis zum 11. September 2016 Werke seiner Privatsammlung zur Verfügung. Darunter befinden sich vor allem selten gezeigte Malereien und Zeichnungen von Ernst Wilhelm Nay und Gerhard Altenbourg, aber auch Bilder von Peter Brüning, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze und Willi Baumeister, um nur ein paar zu nennen. All jene Künstler stehen für die Art Informel in Deutschland und zeichnen sich durch die Hinwendung zu Farbe und Abstraktion aus.
Ernst Wilhelm Nay gilt unterdessen als einer der bedeutendsten Künstler und Koloristen der Nachkriegsmoderne und des deutschen Informel, das sich in der Theorie der Form- bzw. Gegenstandslosigkeit begründet. Realistisch-gegenständliche Kunst wurde von vielen Vertretern der Moderne als Bedrohung der persönlichen Freiheit gewertet und deshalb abgelehnt. Nays farbintensive und mehrfach preisgekrönte Werke waren u. a. auf den ersten drei documenta-Ausstellungen in Kassel vertreten. Seine kunsttheoretischen Ansätze zur Farbe spiegeln sich in den meisten seiner Werke wider. Er erklärte die Farbe zu seinem Metier, als er sagte: „Ich gebe der Farbe nicht nur den Vorrang vor anderen bildnerischen Mitteln, sondern das gesamte bildnerische Tun meiner Kunst ist allein von der Farbe her bestimmt.“ Nach seiner Auffassung entzieht sich die sogenannte Gestaltfarbe jeglicher assoziativen Bewertung. Von der gängigen Lehre der Komplementärfarben oder anderer Harmonie- und Kontrastlehren hielt er nichts. Auch Räumlichkeit erzeugende Tiefe galt es zu vermeiden, suggeriere sie doch bereits zu viel Gegenständlichkeit. Er selbst bezeichnete seine Kunst als farbigen Konstruktivismus. Flächigkeit und Farbigkeit lauten die Stichworte in Nays Werken. Zeugnis dafür sind die derzeit zu besichtigenden Bilder im Angermuseum.
Ihm gegenüber steht der ostdeutsche, in Schnepfenthal im Thüringer Wald geborene Gerhard Altenbourg, der als einer der bedeutendsten deutschen Zeichner der Nachkriegsmoderne gilt. Er blieb zeitlebens in der DDR, war vom Staat aber lange nur geduldet, wohl auch deshalb, weil der im Westen angesehene Maler und Grafiker Mitglied in der Akademie der Künste in Westberlin war und verschiedene Grafikpreise erhielt, aber auch wegen seiner überschaubaren Zahl politisch motivierter Werke. Er selbst bezeichnete sich jedoch als unpolitisch und über gesellschaftlichen Strukturen stehend. Seine Zeichnungen sind zart, wirken fragil und zerbrechlich, was vor allem seine Zweifel gegenüber der Außenwelt symbolisiert – ein Ergebnis der verstörenden Erlebnisse an der Kriegsfront. Später tauschte er die innerliche sowie bildhafte Zurückhaltung und Melancholie gegen Ironie, die er gegenüber dem Erlebten zunehmend empfand. Das ironische in seinen Bildern war Ausdruck und Heilungsmittel zugleich. In einem räumlich vom Rest der Ausstellung abgegrenzten Teil wird der Künstler, dem wegen seiner thüringischen Herkunft eine eminente kunstgeschichtliche Bedeutung zukommt, deßhalb besonders geehrt.
Insgesamt zeigt die Ausstellung eindrucksvoll, wie unterschiedlich die Künstler der Nachkriegsmoderne mit Formen und Farben umgingen und eine Neudefinition des Kunstbegriffs wagten.