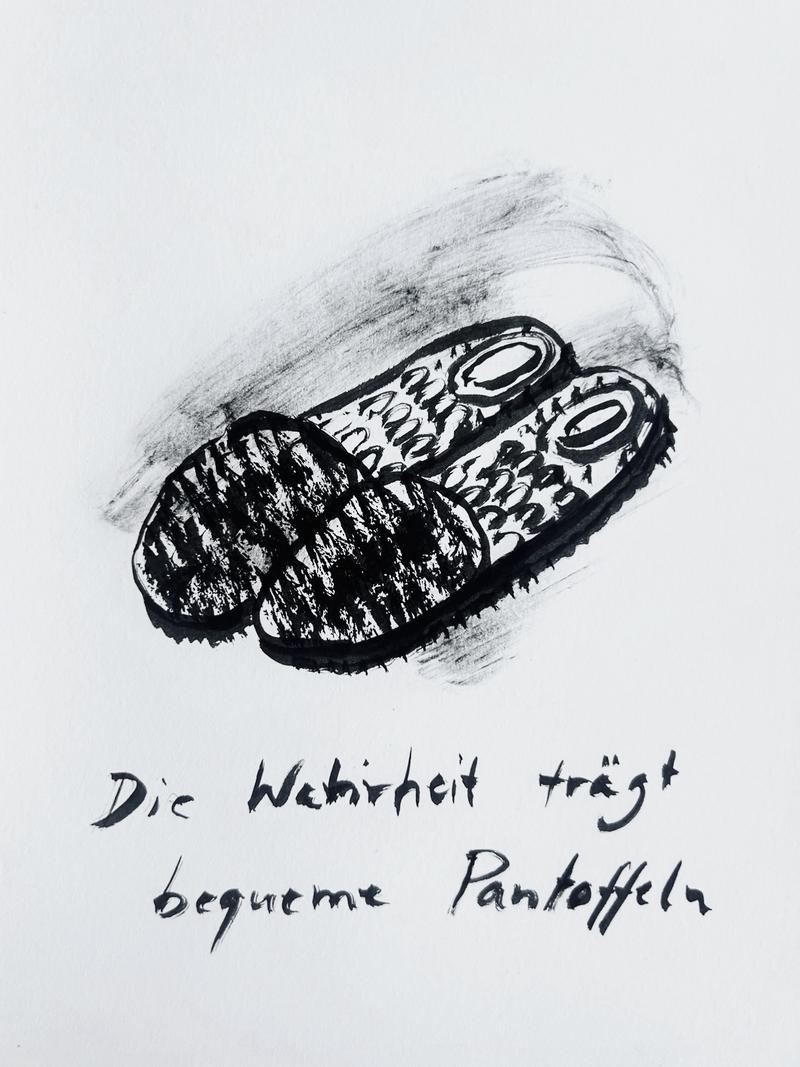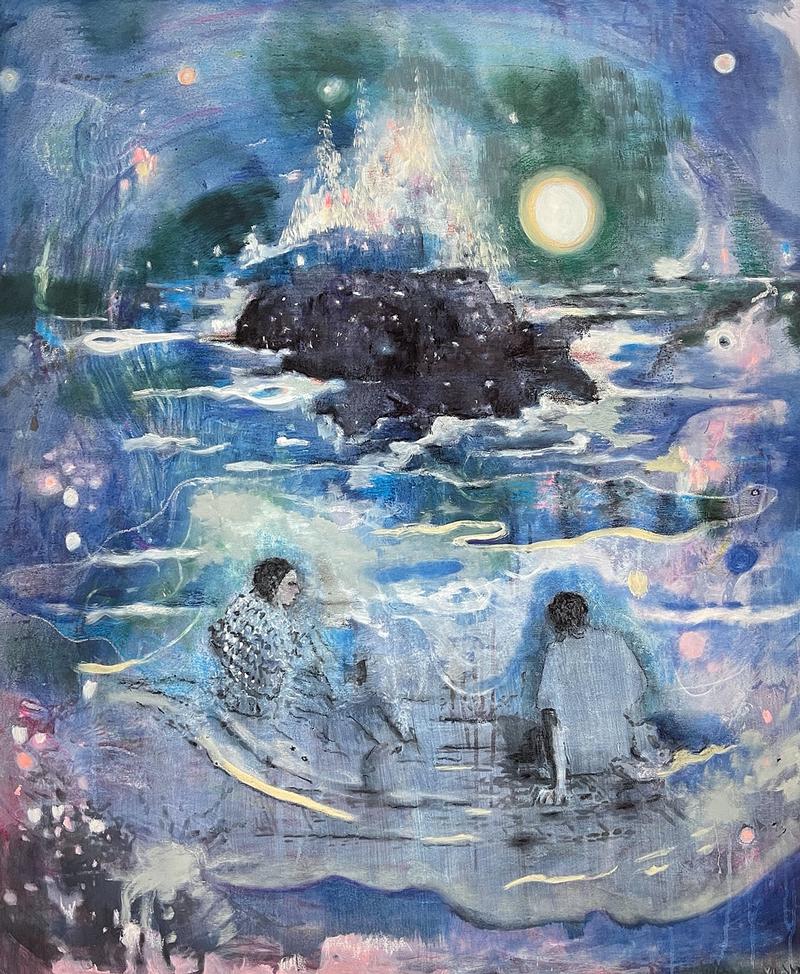Auf SPURENSUCHE in Bamberg
Eine Ausstellung über die Provenienzforschung
veröffentlicht am 01.06.2017 | Lesezeit: ca. 4 Min.
Eine ganz besondere Ausstellung gibt es derzeit in Bamberg zu besichtigen. Noch bis zum 15. Oktober gewährt das Historische Museum Bamberg Einblicke in die städtische Provenienzforschung. Unter dem Titel „SPURENSUCHE – Provenienzforschung in Bamberg | Einblicke. Möglichkeiten. Grenzen“ wird zunächst einmal geklärt, womit sich die Provenienzforschung, eine Disziplin der Kunstgeschichte, die immer mehr Aufwind bekommt, überhaupt beschäftigt. Sie widmet sich der Aufgabe, die Herkunft sowie wechselnde Eigentumsverhältnisse von Kunstwerken wissenschaftlich zu erforschen. In den Fokus der Bamberger Provenienzforscher rücken Kunstwerke, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgungsbedingt entzogen und bisher nicht zurückerstattet wurden. Ist dies der Fall, spricht man von sogenannter Raubkunst. Hier gilt es, die rechtmäßigen Eigentümer zu suchen und faire Lösungen der Rückerstattungen herbeizuführen. Seit der Washingtoner Konferenz im Jahr 1998 sind Deutschland sowie 43 andere Staaten zu dieser Aufgabe verpflichtet. Dabei ist jedoch die Raubkunst strikt von der Beutekunst zu trennen. Beutekunst meint im Gegensatz zur Raubkunst die widerrechtliche Entziehung von Kunstwerken eines Staates während oder nach kriegerischen Auseinandersetzungen.
Ein Blick nach Bamberg zeigt, dass dieses Thema auch hier eine Rolle spielt. Aufschluss darüber gibt die wechselvolle Geschichte des Historischen Museums Bamberg. Das Museum wurde bereits 1838 als Städtische Kunst- und Gemäldesammlung gegründet. In den 1930er-Jahren verlagerte sich jedoch der Sammlungsschwerpunkt. Im Zuge der Neueinrichtung des „Fränkischen Heimatmuseums“ in der Alten Hofhaltung waren nun auch umfangreiche Neuerwerbungen vorgesehen. Seit 2012, als das Projekt zur Provenienzforschung ins Leben gerufen wurde, stellt man sich die Frage nach der Herkunft dieser Neuerwerbungen. Ob es sich bei den Kunstgegenständen um Raubkunst handelt, wurde systematisch untersucht. Da viele Kulturgüter aus dem lokalen Kunsthandel angekauft wurden, stand auch der Kulturraub vor Ort im Fokus der Untersuchungen. In der Ausstellung werden diese Ergebnisse präsentiert.
Daneben zeigt die Ausstellung auch, wie man in dieser Disziplin vorgeht. Dabei müssen zunächst folgende Fragen gestellt werden: Wie identifiziert man Kunstwerke, die ihren Eigentümern unrechtmäßig entzogen wurden? Wie lässt sich angesichts lückenhafter Quellenüberlieferung ein eindeutiger Nachweis erbringen? Und wie geht man mit den als Raubkunst identifizierten Objekten um? Welche Möglichkeiten bieten sich in diesem Zusammenhang? Und welche Grenzen? Die Ausstellung, die von den Museen der Stadt Bamberg konzipiert wurde, stellt dazu konkrete Einzelfälle vor, wie etwa aus den Sammlungen von Emma Budge, Angelo Wassermann oder Willy Lessing. Des Weiteren spürt sie der Frage nach, inwieweit Kunsthandel und Verwaltung am Kulturraub beteiligt waren, was sicher nicht nur angenehme Wahrheiten zu Tage fördert. Zu guter Letzt darf der Besucher einen Blick hinter die Kulissen der umfangreichen Recherchearbeit werfen.
Begleitend zur Ausstellung findet am Mittwoch, dem 23. August, 12.30 Uhr eine Führung statt, die mit dem Titel „Mehr als Gurlitt und Co.: Provenienzforschung in Bamberg“ überschrieben ist. An jedem ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt in die Ausstellung für Familien frei. Mehr Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten finden Sie unter www.museum.bamberg.de.
Hintergrundinformation:
2012 startete zum Thema Provenienzforschung ein vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Stiftung bürgerlichen Rechts) gefördertes dreijähriges Forschungsprojekt. Ein erster Meilenstein war 2014 der Abschluss des Restitutionsverfahrens zum „Schönbornschen Löwenpokal“ aus der Sammlung Budge. Nach Abschluss des Projektes werden nun weitere Ergebnisse der Öffentlichkeit im Rahmen der Ausstellung „SPURENSUCHE“ vorgestellt.
Fotocredits:
Teebecher mit hebräischer Inschrift, Silber, 1882, Foto © Museen der Stadt Bamberg
Sichtung von Grafiken im Depot, Foto © Museen der Stadt Bamberg