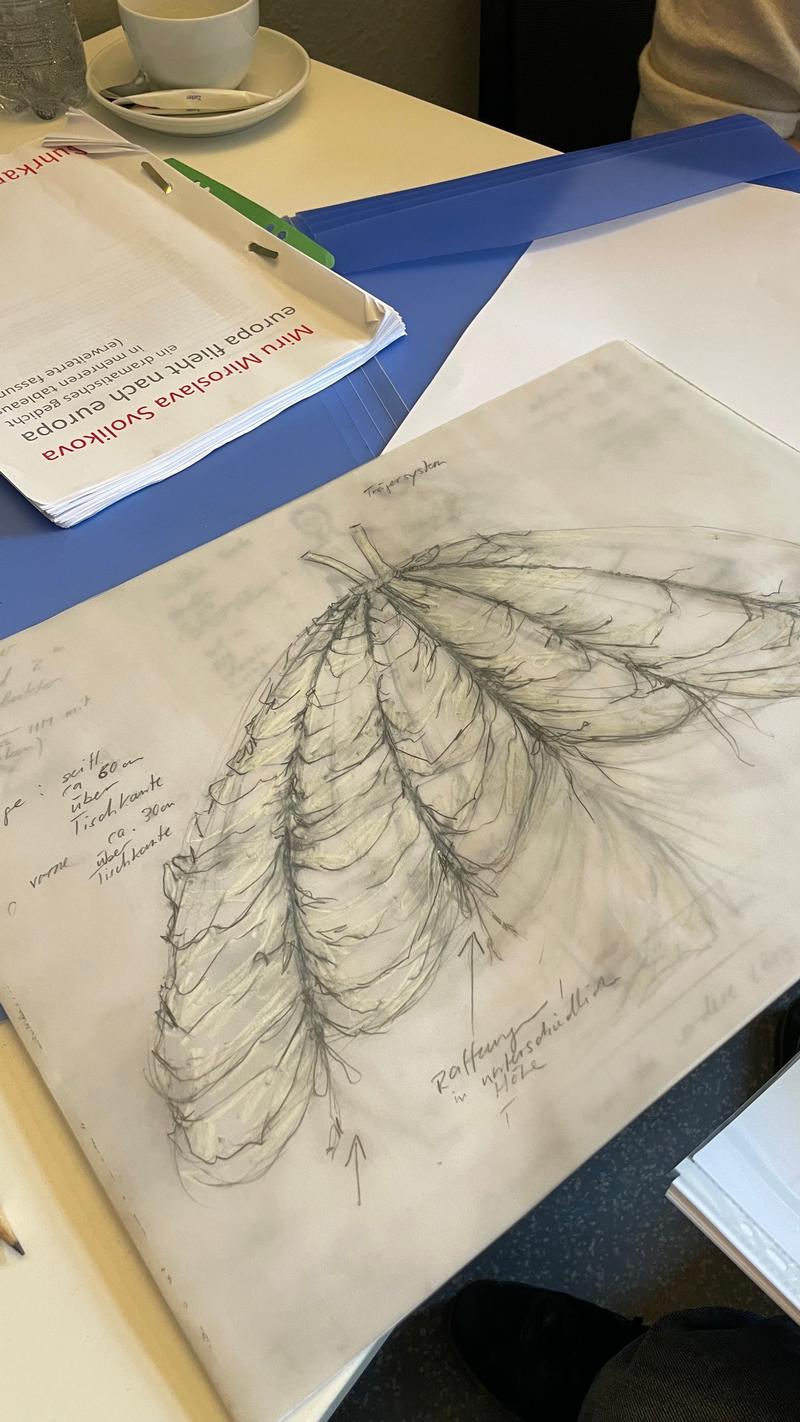„Wär es auch nichts als ein Augenblick“
Frisch aus Bamberg: Ein kürzlich erschienenes Operettenbuch erschließt ganz neue Aspekte einer häufig noch verkannten Gattung
veröffentlicht am 24.03.2015 | Lesezeit: ca. 15 Min.
Wie es der Zufall so will, erschien zeitgleich mit unserem Rundblick über die Operettenpflege an fränkischen Opernhäusern ein brandneues Buch über eben diese Gattung. Geschrieben hat es ein Bamberger Hochschullehrer, und in einer Schriftenreihe der Universität Bamberg ist es auch herausgekommen. Albert Gier, Professor für Romanische Philologie an der Universität Bamberg, hat zahlreiche Publikationen zum Text im Musiktheater (Opern- und Operettenlibretti) und zu den Beziehungen zwischen Literatur und Musik vorgelegt. Sein Buch über die Gattung des Librettos ist zum Standardwerk geworden (Das Libretto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung, Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft 1998). Nun erschien eine umfangreiche Publikation unter dem Titel „Wär‘ es auch nichts als ein Augenblick. Poetik und Dramaturgie der komischen Operette“ (Bamberg: University of Bamberg Press 2014). Ausgehend von den Texten deutscher und französischer Operetten von Offenbach bis Künneke und Benatzky entwirft das Buch eine Phänomenologie des Genres. Darüber unterhielt sich Martin Köhl mit dem Autor.
- Herr Prof. Gier, Sie haben kürzlich ein Buch mit dem Thema „Poetik und Dramaturgie der komischen Operette“ veröffentlicht. Wie kommt ein Professor der Romanistik, der sich im Alltag wohl eher mit Dante oder Proust beschäftigt, dazu, ein Buch über ein Genre zu schreiben, das ja eher der Leichten Muse zuzuordnen ist?
Albert Gier: In meinen Lehrveranstaltungen behandele ich in der Tat eher Proust, Balzac oder Dante als Operette und Musiktheater, doch in der Forschung sind seit ca. 20 Jahren Opernlibretti zu meinem wichtigsten Schwerpunkt geworden. Eine Affinität zum Musiktheater habe ich schon seit meiner Schulzeit, und es hat sich dann einfach so ergeben, dass dieses Gebiet für mich immer wichtiger wurde. In der Überblicksdarstellung zum Libretto, die ich Ende der 90er Jahre veröffentlicht habe, ist der Operette eines von ungefähr 20 Kapiteln zur Geschichte der Gattung gewidmet. Das wollte ich weiter ausführen und vertiefen. Davon abgesehen habe ich eine ausgeprägte Vorliebe für die intelligente Albernheit, von der die besten Operettenlibretti geprägt sind.
- Sie behaupten, die Operette sei „viel geschmäht und lange vernachlässigt“ worden. Aber die Fledermäuse, Vogelhändler, Zigeunerbarone und Bettelstudenten waren doch nie totzukriegen.
Albert Gier: Genau da liegt das Problem – eine Kunstform, die in grob gesagt hundert Jahren allein im deutschen Sprachraum eine vermutlich nicht ganz kleine vierstellige Zahl von Werken hervorgebracht hat, unter denen sicher mehrere hundert grundsätzlich repertoirefähig wären, wurde auf einen Kanon von weniger als zehn Stücken reduziert, die obendrein meist entsetzlich lieblos präsentiert wurden – der Spielleiter, der sonst die Wiederaufnahmen betreute und laut Vertrag eine eigene Inszenierung pro Spielzeit machen durfte, bekam dann die Operette, weil man ihm Verdi oder Mozart nicht zutraute. Der große Regisseur Joachim Herz, der Chefregisseur und Intendant in Leipzig, Berlin und Dresden war, hat in seiner langen Karriere nie Operette inszeniert, weil ihm das laut seiner eigenen Aussage zu schwer war, aber Anfänger und mäßig Talentierte durften sich hier austoben. Volker Klotz hat in seinem Operettenbuch etwas mehr als hundert Werke vorgestellt, die seiner Ansicht nach eine Entdeckung oder Wiederentdeckung lohnen – deutsche, französische Stücke, spanische Zarzuelas etc. Wenn ich eine Liste der aus meiner Sicht aufführenswerten Stücke zusammenstellen sollte, wäre sie mindestens doppelt, eher dreimal so lang. Zum Glück werden sich zumindest manche Theater allmählich der Tatsache bewusst, dass es hier viel zu entdecken gibt: Gießen hat Die oberen Zehntausend von Gustav Kerker – wunderbare Musik – gespielt, die Komische Oper in Berlin hat Paul Ábrahám (Ball im Savoy), Kálmán (Arizona Lady) und anderes gemacht, Dortmund spielt z.Zt. Roxy und ihr Wunderteam, Ábraháms Fußball-Operette, von der es nicht einmal eine alte Rundfunk-Aufnahme gibt…
- Warum schreiben Sie „komische Operette“, ist das komische Element angesichts von Ironie, Frivolität und Heiterkeit nicht selbstverständlich?
Albert Gier: Man hat zweifellos schon mehr gelacht als in Land des Lächelns, Friederike, Giuditta und den anderen Operetten, die Franz Lehár für Richard Tauber schrieb. Die meisten, aber eben nicht alle Operetten gehören (wie die meisten komischen Opern, Opere buffe etc.) zu dem Genre, das man ‚musikalisches Lachtheater‘ nennen kann; es gab aber von Anfang an auch Stücke, die das Publikum nicht amüsieren, sondern rühren wollten (wobei es gar keinen großen Unterschied macht, ob sie glücklich oder unglücklich enden). Unter dem Einfluss des Kinos – im deutschen Sprachraum zusätzlich begünstigt durch die prätentiöse Humorlosigkeit der von den Nationalsozialisten geförderten Künstler - breitet sich dann ein mit Trivialpsychologie gepaarter, kleinbürgerlich verlogener Pseudo-Realismus aus, der mit Ironie und Frivolität nichts im Sinn hat. Ich denke, zwischen diesen Elaboraten und den genuinen Operetten sollte man klar unterscheiden; daher die Bezeichnung „komische Operette“, die im übrigen eine ehrwürdige Tradition hat: Als die Autoren das Fledermaus-Libretto (noch unter dem Titel „Dr. Fledermaus“) der k.u.k. Zensur vorlegten, stand auf dem Titelblatt ‚Komische Operette‘, während es später in den gedruckten Ausgaben nur noch ‚Operette‘ heißt.
- Sie sind auch Libretto-Fachmann. Wie steht es denn um die sprachliche Qualität der Operetten-Libretti?
Albert Gier: Nicht wesentlich besser oder schlechter als bei der Masse deutscher Operntextbücher aus dem 19. Jahrhundert. Im Deutschen stellt sich der Endreim halt nicht so zwanglos ein wie in den romanischen Sprachen, deshalb findet man z.B. in einem dramaturgisch genialen Libretto wie dem von Beethovens Fidelio so viele holprige und ungeschickte Verse. Die Operetten-Dichter waren im allgemeinen erfahrene, routinierte Theaterleute, die wussten, wie man eine Intrige konstruiert – die Geschichten sind in sich stimmig, an den richtigen Stellen stehen prägnante Gesangstexte, die dem Komponisten viele musikalische Möglichkeiten eröffnen. Gute Textdichter halten dabei das prekäre Gleichgewicht zwischen Illusion und Desillusionierung: Wir alle wissen, dass es in der unvollkommenen Welt vollkommenes Glück nicht gibt, es tut aber manchmal gut, für die Dauer eines Theaterabends daran zu glauben. Die Librettisten bieten dem Publikum, was es sich wünscht, sorgen aber dafür, dass ein aufmerksamer Zuschauer nicht vergisst, dass alles gelogen ist; man geht ihnen (durchaus lustvoll) auf den Leim und amüsiert sich zugleich selbst darüber, wie empfänglich man trotz allem für Kitsch ist. Das macht den Reiz der Bücher aus; die paar banalen Reime, verunglückten Sprachbilder und holprigen Verse, die es (genau wie in den zeitgenössischen Opernlibretti) auch gibt, sind demgegenüber gar nicht so wichtig. Man muss allerdings zugeben, dass die sprachliche Qualität der französischen Libretti im allgemeinen höher ist als bei den deutschen; und frecher, erotischer, anspielungsreicher sind die französischen Bücher sowieso.
- Ist die Operette simple Unterhaltungskunst bzw. pure Volksbelustigung und daher jedem zugänglich oder birgt sie auch Raffinement für das Bildungsbürgertum?
Albert Gier: Etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Autoren, und hatte ein nicht unbeträchtlicher Teil des Publikums seine Klassiker parat. Auf dieses kulturelle Wissen konnten die Librettisten zurückgreifen, und sie konnten damit spielen. Die Schule, das Gymnasium umgab die antike Mythologie, die Weimarer Klassik (oder auch die großen französischen Autoren des 17. Jahrhunderts) mit einer Aura des Erhabenen, den Zuschauern, die sich im Deutsch-, Französisch- oder Lateinunterricht gelangweilt hatten, machte es Spaß, wenn das Bildungsgut ein bisschen durch den Kakao gezogen und z.B. mit moderner Unterhaltungsliteratur durcheinander gewirbelt wurde – das haben schon Offenbachs Librettisten so gemacht. Außerdem reflektieren die besseren Libretti immer auch die Konventionen der Gattung: In den Lustigen Nibelungen von Oscar Straus z.B. wird Siegfried natürlich nicht von Hagen erschlagen. Er ahnt aber, dass seine angeheiratete Verwandtschaft Finsteres vorhat, und fragt den ‚Vogel‘, der selbstverständlich aus Wagners Siegfried kommt: „Werde ich sterben?“ Der Vogel antwortet: „Unsinn, in ‘ner Operette! Sie werden leben und gesund sein.“ Das ist einfach entwaffnend.
- Der Nürnberger Theaterintendant Peter Theiler sagte mir kürzlich, viele Operetten seien heute kaum mehr aufführbar, weil das Publikum die zeitbedingten Anspielungen nicht mehr verstünde. Könnte dem das Regietheater durch Aktualisierung abhelfen?
Albert Gier: Wenn Peter Theiler recht hätte, könnte heute niemand mehr den Don Quijote des Cervantes lesen, denn das ist eine Parodie auf Ritterromane der Zeit um 1600, von denen ein durchschnittlich gebildeter Leser heute nicht einmal mehr die Titel kennt! Selbst bei Offenbach kommen Anspielungen auf die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart nur punktuell vor; wenn man sie versteht, ist es gut, wenn man sie überhört, ist das Stück immer noch witzig genug. Es ist zugegebenermaßen ein gewisses Problem, wenn die Zuschauer in der Schönen Helena überhaupt nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht, dass Agamemnon nach der Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg von seiner Frau erschlagen wird und dass sein Sohn Orest, den wir als angehenden Playboy kennenlernen, seine Mutter und ihren Liebhaber töten wird, um den Vater zu rächen; aber das kann man notfalls in der Inhaltsangabe im Programmheft unterbringen.
Bei Aktualisierungen bin ich skeptisch: Das funktioniert bei wirklich großer, überzeitlich gültiger Kunst – die überzeugendsten Resultate hat das ‚Regietheater‘ (wenn wir diesen problematischen Begriff verwenden wollen) m.E. bei Mozart und Wagner, den beiden bedeutendsten Musikdramatikern aller Zeiten, erzielt. Bei aller Liebe zur Operette muss man zugeben, dass ihre Libretti deutlich schmalbrüstiger sind; natürlich kann man sie an die Gegenwart heranholen, aber wenn man quasi eine neue Geschichte zur vorhandenen Musik erfindet, geht das fast immer schief. Ich muss auch gestehen, dass ich, wenn ich die Möglichkeit hatte, die originalen Dialoge mit modernen Bearbeitungen zu vergleichen, die Fassung der Autoren durchweg witziger und prägnanter fand. In Frankreich greift man in der Regel allenfalls sehr vorsichtig in die Texte ein, man spielt die Stücke u.U. gekürzt, aber sonst unverändert; auf die Gegenwart verweist eher ein modernes Bühnenbild, das dann in durchaus stimulierenden Widerspruch zum Text geraten kann, der auf die Lebensverhältnisse einer lange vergangenen Zeit Bezug nimmt. Das scheint mir ein sehr Erfolg versprechendes Verfahren zu sein.
- Bei welchem Repertoire liegen Ihre Präferenzen und warum?
Albert Gier: Ich mag sehr vieles, aus unterschiedlichen Gründen: Natürlich Offenbach, in dessen Stücken in gewisser Weise alle Möglichkeiten, die die Kunstform später entfaltet, schon angelegt sind; dann die französischen ‚Kammeroperetten‘ der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, von Christiné, Maurice Yvain, Raoul Moretti u.a.: Die Texte sind frecher, direkter, ‚großstädtischer‘, als die Zensur des Zweiten Kaiserreichs es Offenbach gestattet hätte, die Geschichten z.T. aberwitzig, die Musik unwiderstehlich (aus Maurice Yvains Pas sur la bouche hat der große französische Regisseur Alain Resnais am Ende seiner langen Karriere, 2003, eine hinreißenden Film gemacht); von der deutschsprachigen Operette mag ich Franz von Suppé, der m.E. der tüchtigste Musiker unter den Operettenkomponisten des 19. Jhs überhaupt ist; Johann Strauß schreibt natürlich wundervolle Musik (auch in seinen weniger bekannten Stücken – Die Göttin der Vernunft z.B. ein lange verschollenes Stück, dessen Aufführungsmaterial erst kürzlich wiedergefunden wurde, ist musikalisch grandios!), war aber kein genuiner Musikdramatiker; Oscar Straus, Leo Fall, Eduard Künneke haben herrliche Musik geschrieben und sind nicht immer, aber häufig wunderbar albern (meiner Vorliebe für Albernheit kommt durchaus auch Franz Lehár in der ersten Phase seiner Karriere entgegen; außer der Lustigen Witwe und dem Grafen von Luxemburg mag ich z.B. den Göttergatten, den Sterngucker etc., während die späten Tauberiaden nicht unbedingt zu meinen Favoriten zählen); sehr empfänglich bin ich auch für die absurde Komik der Libretti William S. Gilberts, die Arthur Sullivan vertont hat… und wenn ich noch ein bisschen nachdenke, kämen sicher noch zwei Dutzend andere Namen hinzu.
- Wie steht es um den Übergang zum bzw. die Abgrenzung vom Musical?
Albert Gier: In der Frühphase sind die Unterschiede gar nicht so groß; Kiss Me Kate z.B. hat sehr vieles mit Operetten des frühen 20. Jhs gemeinsam. Heute ist das Produktionssystem beider Genres radikal verschieden: Im deutschen Sprachraum sind die spezialisierten Operettentheater, die regelmäßig neue Stücke in aufwendigen Inszenierungen herausbrachten und sie en suite spielten, bis das Publikumsinteresse nachließ, infolge der Verstaatlichung der Privattheater in der Zeit des Nationalsozialismus verschwunden, Operette wird heute vor allem in Stadttheatern gespielt und aus dem Ensemble (mit Opernsängern bzw. Schauspielern) besetzt, bis 1933 waren Operettensänger hoch bezahlte Spezialisten, wie im amerikanischen Musical. In Frankreich haben die Operetten von Francis Lopez bis in die 60er Jahre lange Aufführungsserien in spezialisierten (Pariser) Häusern, dann verändert sich auch dort die Theaterlandschaft. Soweit ich es beurteilen kann (die neuere Musical-Produktion kenne ich nicht gut), hat im Musical die Inszenierung Werkstatus, Ausstattung, szenische Effekte etc. der Uraufführung sind bei Lloyd Webber z.B. Bestandteil des Spektakels, d.h. die Stücke können nicht unterschiedlich inszeniert werden; die Produktionsweise ist extrem arbeitsteilig, am Libretto schreiben nicht zwei Autoren wie in der Operette üblich, sondern vier oder fünf Spezialisten jeweils für einen bestimmten Bereich, nicht nur Librettist und Komponist, auch der Choreograph, der Bühnenbildner etc. sind Mitautoren, weil man angesichts der exorbitanten Kosten z.B. einer Broadway-Produktion nichts dem Zufall überlassen kann und bemüht sein muss, soweit wie möglich dem Publikumsgeschmack zu entsprechen, was natürlich leicht zu einer gewissen Beliebigkeit führen kann. Aber wie gesagt, meine Kenntnis neuerer Musicals ist recht oberflächlich und lückenhaft.
- Warum steht Ihr Buch unter dem Motto „Wär‘ es auch nichts als ein Augenblick“?
Albert Gier: Der Titel zitiert den „süchtigen Walzer“ (Volker Klotz) der Protagonistin aus Franz Lehárs Eva. Er schien mir die bereits angesprochene Ambivalenz des Genres, das ein (individuelles) Glück für die Dauer der Aufführung als möglich und erreichbar behauptet (im Wissen um seine Unerreichbarkeit), prägnant zusammenzufassen.
Copyright Foto:
Prof. Dr. Albert Gier, Foto © privat