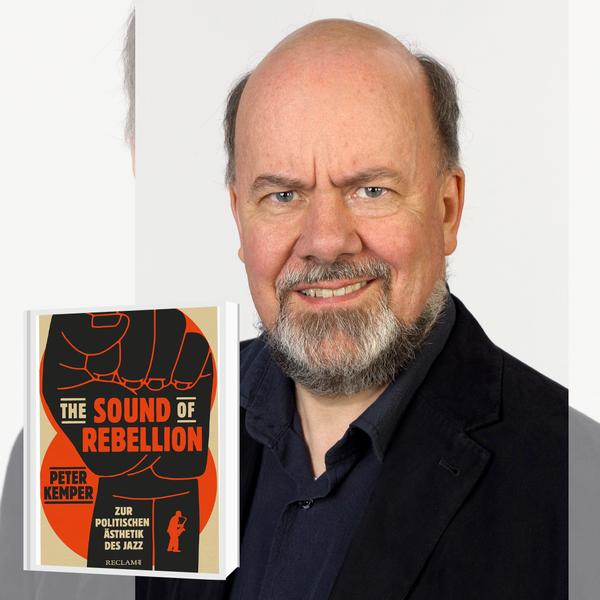Und jährlich grüßt das Murmeltier
Fiskalische Kulturkämpfe landauf landab
veröffentlicht am 30.01.2025 | Lesezeit: ca. 13 Min. | von Oliver Will
Furcht und Protest hallen derzeit durch das Land. Das Leben wird teuer, es herrscht Krieg, auch in Europa, die Welt knüpft vorsätzlich an ihr Erbe imperialen Größenwahns an, die Gesellschaften verrohen, die Politik brennt im Lauffeuer der Populisten, die Spatzen pfeifen das Ende der Demokratien von den Dächern und last und scheinbar least verkünden Bund, Länder und Kommunen offenbar den Winterschlussverkauf ihrer einzigartigen Kulturlandschaft.
Berlin, München, Köln und zahlreiche andere Städte kämpfen um ausgeglichene Haushalte und sind bei den Kürzungen bestimmter Kulturausgaben alles andere als zimperlich. Zwar sind die Kulturetats anteilig mit irgendwo zwischen 2 und 9 % am Gesamthaushalt sehr überschaubar. Der Rotstift bleibt ihnen dennoch nicht erspart und fällt schon auch einmal dicker aus. Zumal der Kultur nach wie vor die Degradierung zur „Freiwilligkeit“ zugemutet wird. Daran hat die Ampel trotz klarem Statement der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien leider nichts geändert.
Nun ist eine lauter werdende Kulturlobby im Reigen der alljährlichen Haushaltsberatungen kein Novum. Für 2025 allerdings scheint die Lage für einige Einrichtungen und insbesondere für die Freie Szene, nach der kaum verdauten Pandemie-Flaute, erneut sehr bedrohlich. Der Bund will laut Haushaltsentwurf beim Kulturetat zwar minimal auf gut 2,2 Milliarden Euro zulegen, der Kostenprogression der Kulturhaushalte allerdings wird das nicht gerecht. So sehr einige ausgewählte Bereiche deutlich mehr profitieren sollen (z.B. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Deutsche Welle und die Filmförderung sowie die Kulturhauptstadt Chemnitz und die Übernahme der Kostensteigerungen der letzten Tarif- und Besoldungsrunden der Bundeskultureinrichtungen), so stark sind die Einschnitte in anderen (z.B. Bundeskulturfonds in Höhe von bis zu 50 %).
Die Kürzungen würden den Förderlinien und Programmen nicht gerecht, die jüngst, teils auch im Zusammenspiel mit Ländern und Kommunen oder Akteuren des kulturellen Lebens, entwickelt und erstmalig ausgeschrieben wurden oder noch in Arbeit sind, so hallt es aus den Verbänden. Die Absicht des Bundeskulturfonds, der Freien Szene zur Durchsetzung von Honoraruntergrenzen oder der Nachhaltigkeits- und Awareness-Empfehlungen der Kulturförderung der BKM zu verhelfen, drohe zum Lippenbekenntnis zu verfallen. Dabei ist generell offen, ob diese Vorsätze beim erneuten Aufstellen des bisher nicht ausgeglichenen und nicht verabschiedeten Bundeshaushalts unter neuer Regierungskoalition auch halten werden oder ob es noch schlimmer kommt. Mechthild Eickhoff, Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur, bestätigt uns die unsichere Lage, auch seitens der Förderprogramme: „Wie es mit der Bundeskulturförderung weitergeht, wird erst nach den Bundestagswahlen klar sein. In 2025 können wir, der bundesweite Fonds Soziokultur, jedoch voraussichtlich mit 3,9 Mio. Euro (2024: 5,25 Mio. Euro) Fördermitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien rechnen. Aber die Kultur steht jetzt schon auf der Streichliste in einigen Bundesländern und vielen Kommunen. Kulturförderung ist immer Ko-Förderung, es droht also ein Dominoeffekt: Bricht eine Finanzierungsquelle weg, geraten ganze Strukturen ins Wanken, die nicht einfach wieder zu beleben sind.“
Berlin hatte beim Verabschieden des Doppelhaushaltes 2024/25 noch euphorisch Richtung ehrgeizige Kulturentwicklung geschielt, eine sorgfältige Gewichtung für zahlreiche Projekte angedeutet und in der Haushaltsrede zuversichtlich und inhaltlich überzeugend präsentiert. Die Hauptstadt holte für den Nachtragshaushalt 2025 jedoch jüngst das große Besteck für Kürzungen heraus. 130 Millionen weniger für Kultur wurden genannt; bei Gesamtsparmaßnahmen in Höhe von 3 Milliarden Euro. Die Logik dahinter erschließt sich den wenigsten. Die Berliner Kulturszene brodelt; einige Einrichtungen bangen existentiell. Zahlreiche Verantwortliche werden in offenen Zitaten sehr deutlich. Der konservative Kultursenator beschwichtigt. Der regierende Bürgermeister, Kai Wegener, ruft zu mehr Wirtschaftlichkeit auf. Immerhin wurde ein Baustopp bei der Komischen Oper abgewendet. Auf Kosten anderer Kulturträger allerdings. Es blieb nach Haushaltsbeschluss bei der Aufgabe, 130 Millionen zu kürzen. Im Kulturbereich kürzt Berlin überproportional 6,5 % der gesamten Konsolidierung zusammen, obwohl dieser nur 2,1 % des Gesamtetats ausmacht.
Ähnliche Botschaften kamen aus München. Der Haushalt 2025 sei um 200 Millionen Euro zu kürzen. 16,8 Millionen davon sollen auf das Kulturreferat entfallen. Bereits für 2024 erfolgte eine Konsolidierung um 18,8 Millionen. Die Tariferhöhungen mussten aus den laufenden Etats gestemmt werden. Die Landeshauptstadt holt, offensichtlich wiederholt, womöglich anhaltend zu Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Kultur aus. Hier sollen 8,5 % des gesamten Sparvolumens realisiert werden, obwohl sie anteilig an den Gesamtausgaben nur 3 % ausmachen. Begründet wird das vor allem mit der Freiwilligkeit der Kulturleistungen. Stark betroffen seien die Theater der Stadt. Der Ausgleich wenigstens der tariflichen Erhöhungen scheint alles andere als gesichert. Gleichermaßen steht die Freie Szene vor großen Herausforderungen. Zuletzt klang es jedoch etwas versöhnlicher. Die Tarifentwicklungen sollen zu einem guten Teil berücksichtigt werden, die Freie Szene, wo möglich, verschont, so heißt es. In der Haushaltsrede des Kämmerers Mitte Dezember ist von Kultur schließlich gar nicht weiter die Rede. Die konkreten Einschnitte bleiben am Ende unter dem Radar. Der Münchner Haushalt bleibt unterdessen, mit Blick auf die üppige Verschuldung, eine sehr große Herausforderung. Der kulturelle Kahlschlag scheint vorprogrammiert, wenngleich in Teilen vertagt, nicht zuletzt in den Münchner Wahlkampf für 2026 hinein.
Auch in Köln kursieren zweistellige Kürzungen in verschiedenen Bereichen. Der Deutsche Musikrat beklagt dort eine Kürzung von 27 %. Seine Generalsekretärin, Antje Valentin, bringt es auf den Punkt: Köln, Berlin und München seien die Vorboten eines Flächenbrandes, der unbedingt zu verhindern ist. Der Kölner Doppelhaushalt zeigt auffällige Degression für 2025 und vor allem auch 2026. Das Festival Acht Brücken verschwindet – blickt man auf den entsprechenden Haushaltsposten – im nächsten Jahr von der Landkarte der zeitgenössischen Musikfestivals. Gleichermaßen bedroht fühlt sich ein Großteil der Musik- und Literaturszene. Ähnlich wird der Haushaltsentwurf für die Akademie der Künste der Welt interpretiert. Dabei entwickelt sich der Kulturhaushalt insgesamt leicht wachsend. Die Freie Szene jedoch soll mehr als 20 % einsparen. Große Teile sehen sich auch in Köln dadurch existentiell bedroht. Bei den Museen legt Köln seine Hoffnungen auf Synergien, höhere Eintrittspreise und mehr Besucher durch gesteigertes Marketing. Das dringend nötige Zentraldepot scheint auf Eis gelegt.
Ferner sind auch innerhalb der Metropolregion Nürnberg aus verschiedenen, wenngleich längst nicht allen Städten, Hiobsbotschaften zu hören. Von leicht wachsenden Kulturhaushalten mit dennoch diversen Einschnitten bis zu breiten Sparmodellen reicht die Palette. Investive Maßnahmen werden beendet, so sie längst begonnen worden waren. Was zu stoppen ist, wird gestoppt. Bamberg glänzt mit einer Moratoriums-Liste. Die Kulturbudgets würden allerdings leicht gesteigert. Man habe in den letzten Jahren vorgebaut und könne so größere Einschnitte in 2025 vermeiden. Ausgeglichene Haushalte haben dennoch nicht alle Einrichtungen.
Ganz anders schildert Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth aus Erlangen die Situation: Rund 10 % Kürzung durchschnittlich treffen dort alle Kultureinrichtungen sowie Zuschussempfänger der Kulturförderung. Strukturell zerschlagen soll dabei allerdings nichts werden. Die Angebote bedürfen aber einer deutlichen Reduzierung. Für das Figurentheater-Festival sowie das Erlanger Poetenfest bedeutet das eine Reduktion um etwa die Hälfte ihrer Dimension. Die Generalsanierung des KuBiC Frankenhofs wird mit 8,5 Millionen gestemmt. Weiterhin sind gut 6 Millionen für den Neubau des Bürgerzentrums Büchenbach veranschlagt. Während die Planungen für das Bürgerhaus Eltersdorf aufgeschoben werden.
In Anbetracht des Haushaltslochs in Erlangen sieht sich auch das E-Werk starken Einschnitten mit erheblichen Auswirkungen ausgesetzt. Dem renommierten soziokulturellen Zentrum fehlen dieses Jahr für die Programmierung 290.000 Euro. Der Fördervertrag bleibt auf ein Jahr befristet, statt der üblichen drei Jahre. Das sorgt für Planungsunsicherheit. 80 soziokulturelle Projekte stehen damit auf der Streichliste. Darunter Nachwuchsförderprojekte wie der beliebte Umsonst und Drinnen Club, das legendäre Newcomer-Festival, Kinder- und Jugendveranstaltungen sowie Diskussionsabende. Teile des Gesamtprogramms müssen komplett entfallen. In einer Pressemitteilung des E-Werks zeigt sich Geschäftsführer Jan-Peter-Dinger trotz allem zuversichtlich: „Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen,“ sagt Dinger. „Die Rückmeldungen nach dem ersten Bekanntgeben unserer misslichen Lage, haben mich positiv gestimmt. Es wurde oft gefragt, wie man uns konkret helfen kann. In kürzester Zeit haben wir dazu eine erste Möglichkeit entwickelt: Man kann durch unterschiedliche finanzielle ‚Solidaritäts-Beiträge‘ unsere soziokulturelle Programmarbeit unterstützen“. Helfen können Privatpersonen oder Unternehmen etwa via „Fliesen-Patenschaft“ und anderer geplanter Aktionen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Kulturzentrums.
Benedikt Stegmayer in Würzburg wiederum gibt sich sehr zufrieden und hält den Kulturetat für angemessen. Bedrohliche Kürzungsszenarien sieht er nicht. Ähnliche Töne erreichen uns aus Erfurt. Von der jüngsten Theaterpleite ist da keine Rede, trotz dass das Theater fast 50 % des Kulturbudgets beansprucht. Die Steigerungen des Einzelplan 3 (Kultur im weiteren Sinne) konnten in den letzten fünf Jahren bei den Ausgaben um 35 % gesteigert werden. Das klingt in der Tat bemerkenswert. Auch Nürnberg meldet wachsende Kulturfördertöpfe. Streichungen von spezifischen Projekten und Förderprogrammen oder die Schließung von Investitionen sind nicht vorgesehen. Von Kürzungen ebenfalls ausgenommen sind Mittel der konkreten Kulturförderung, auch wenn diese eine freiwillige Leistung der Stadt Nürnberg darstellen. Der Geschäftsbereich Kultur leistet allerdings auch seinen Beitrag zum beschlossenen Sparpaket in Höhe von insgesamt 4,1 Millionen Euro. Bezüglich der Sanierung ihrer Kulturhäuser meldet Nürnberg den Abschluss der umfangreichen Sanierung des Künstlerhauses, während laufende Maßnahmen im Museum Industriekultur sowie im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände zu verzeichnen sind. Der Baustart für die Kulturvorhaben in der Kongresshalle erfolgte am 13. Dezember 2024. Im mittelfristigen Investitionsplan stehen für diese Bereiche in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt 369,9 Millionen Euro zur Verfügung. Auch die Frankenmetropole zeigt beachtlichen Investitionsmut.
Die Signale der großen Metropolen bestätigen sich innerhalb der EMN und mit Blick nach Unterfranken und Thüringen also nur bedingt. Der Mut für investive Maßnahmen allerdings ist in vielen Kommunen geschwunden. Wegweisende Projekte sind mindestens auf Pause gedreht. Nicht jede Kommune kürzt ihren Kulturbereich. Vor allem nicht in bedrohlicher Höhe. Ausgewählte Einrichtungen allerdings, vor allem in Erlangen, trifft der Sparzwang 2025 dann durchaus, manche empfindlich. Leicht steigende Kulturetats aber täuschen vielerorts dann doch rhetorisch über die problematischen Lagen, zum Beispiel auch bei den Stadttheatern der Region, hinweg. Sie sind personalkostenintensiv. Das Baumolsche Kosten-Dilemma schreibt sich seit vielen Jahren in sie hinein. Die Tarifsteigerungen schlagen bei Theatern deutlich in die Haushalte. Werden diese über mehrere Jahre nicht ausgeglichen, entstehen Engpässe in sämtlichen anderen Bereichen. Gebäude, Marketing, Programmkosten usw. Dass dies zwangsläufig zu defizitären Jahresabschlüssen führt, liegt auf der Hand. Der Programmatik tut das jeweils auch nicht gut. Ähnliche Entwicklungen sind bei anderen Einrichtungen zu beobachten: Musikschulen, Büchereien, Fördertöpfe für die Freie Szene. Letztere trifft es am schnellsten und härtesten, da hier kein Tarifrecht schützt, strukturelle Zerstörung allzu leise verhallt.
Was bedeutet das? Mechthild Eickhoff, Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur, gibt uns ihre Antwort: „Kulturausgaben zu kürzen, bedeutet, an der Innovationskraft einer Gesellschaft zu sparen. In Kunst und Kultur werden Ideen für den Umgang innerhalb unserer Gesellschaft verhandelt und reflektiert: Wie erleben wir ein Ereignis, was berührt jede Einzelne, was denken andere und wie könnte etwas völlig anders sein? Film, Tanz, Ausstellung, Spoken Word, Musik, Theater, Nachbarschaftsorchester – diese Formate sind mehr als Unterhaltung. Es sind Vorschläge, Perspektivwechsel, sinnliche Gedankenspiele und oftmals ein intuitives Erlebnis von Gemeinschaft. Wenn wir diesen Raum der Fantasie und Kreativität, des Mitfühlens – und zwar aller in unserer Gesellschaft – immer kleiner machen, dann hat das erheblich negative Auswirkungen auf die Menschlichkeit untereinander. Die Förderung von (insbesondere freier) Kunst und Kultur ist eine Investition in die Erneuerungskraft einer Gesellschaft. Man sollte sie genauso ernst nehmen wie die Wirtschaftsförderung.“
Irgendwo zwischen Wunschlisten, Streichlisten, Traumschlössern und Apokalypseszenarien oszillieren Politsprech, Kämmererdeutsch und Kulturlobbying alle Jahre wieder in mehr oder weniger sortierten Finanzierungskonzepten und -debatten. Während die einen hohe Verantwortung für Kultur signalisieren und daraus versöhnliche Anerkennung unserer einzigartigen Kulturlandschaft ableitbar ist, geben andere in ihren Kulturentwicklungen die Elefanten im Kulturladen. Das Maß der Freiwilligkeit hält nicht alle ab, sich gezielt zur Kultur zu bekennen. Andere nutzen dies stetig zur Rechtfertigung überproportionaler Kulturkürzungen. Dabei liegt deutlich auf der Hand, dass bei Anteilen am Gesamthaushalt von 3 bis 9 % erforderliche Sanierungsprogramme für den Haushalt aus der Kraft der Kulturhaushalte allein nicht zu stemmen sind. Schon gar nicht um den Preis eines kontinuierlichen Abbaus der einzigartigen Kulturlandschaft unseres Landes. Nicht in Zeiten lokaler bis globaler Herausforderungen, die Gesellschaften in großem Stil auf die Probe stellen. Vielmehr gilt es, die transformative und integrative Kraft der Kultur stärker zu nutzen, um diesen Aufgaben erfolgreich zu begegnen. Ohne die kreativen Kräfte aus wirtschaftlicher Motivation oder andere Legitimationsmodelle dabei zu vernachlässigen, wie diese ja nicht nur eine große Tradition und Historie haben, sondern auch einen aktuell regen Diskurs führen, der eindrücklich darlegt, warum jeder Cent für Kultur gerechtfertigt ist und vielfach zurückwirkt.
(Quellen: Tagesschau, BR 24, Süddeutsche Zeitung, Kölner Stadt-Anzeiger, Kulturrat Köln, Deutscher Musikrat, Pressestellen der Kommunen, BKJ, dpa, Monopol, tipBerlin)