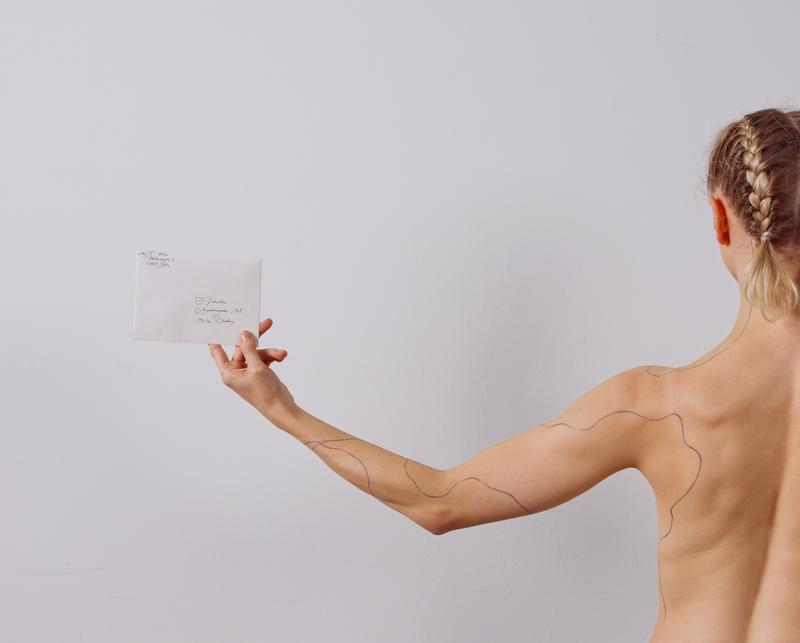Repetitive Wortspiele und ein Chamäleon
Das ETA Hoffmann Theater Bamberg bringt mit „Die Eingeborenen von Trizonesien“ eine Uraufführung auf die Bühne seines Studios
veröffentlicht am 17.01.2025 | Lesezeit: ca. 4 Min. | von Martin Köhl

„Die Eingeborenen von Trizonesien“ am ETA Hoffmann Theater Bamberg, v.li. Marek Egert, Eric Wehlan, Magdalena Helmig, Stefan Herrmann, Foto © Martin Kaufhold
Es klingt staubtrocken, vom Bildungsauftrag eines Theaters in einer Zeit zu reden, in der auf deutschen Bühnen vornehmlich Befindlichkeiten verhandelt werden. Das ETA Hoffmann Theater Bamberg ist mit „Die Eingeborenen von Trizonesien“ auf diese ureigene Pflicht zurückgekommen, freilich ohne staubige Trockenheit. Aber konnte diese sehr spezifische Stunde Geschichtsunterricht als Nachhilfe für das Wissen über die Nachkriegszeit dienen?
Björn SC Deigner greift mit dem Titel seines Stückes, das jetzt im Bamberger Theaterstudio uraufgeführt wurde, auf die zusammenfassende Benennung der drei westlichen Besatzungszonen zurück: „Trizone“. Deren Bewohnerinnen und Bewohner wurden im rheinischen Karneval „Trizonesier“ genannt. Anhand dieses speziellen Humanbiotops bietet Deigner einen kurzweiligen Gang durch achtzig Jahre Geschichte an.
Der beginnt bei der Jukebox und beim WM-Tor 1954, setzt sich mit Honolulu-Strandbikini, Klosterfrau Melissengeist und Afri-Cola fort, streift die 68er-Zeit und den Oktoberfest-Anschlag und landet dann bei Helmut Kohls "Blühenden Landschaften", also zwangsläufig auch bei den „Quattrozonesiern“. Der Rote Faden ist die Suche nach einer Verfassung, die bekanntlich im Grundgesetz endet und öfters die Herren in den roten Roben auftreten lässt.
Es gibt aber noch einen anderen Faden, und der hat die Farbe Braun. Das subkutane Fortwirken dieser Farbe wird in Deigners Text ständig beschworen, allerdings nicht immer aufgrund eindeutiger Bezüge. Insofern privilegierte das die Älteren, also die sowieso gut informierte Zuschauerschaft, die sich auch auf bloße Andeutungen einen Reim machen kann. Mit Blick auf das aktuelle Wahlverhalten jüngerer Menschen hätte manches konkretisiert werden dürfen.
Beispiel 70er Jahre: Das war nicht nur die Zeit von Baader/Meinhof, es war auch die Zeit, in der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung abgelehnt wurden, die auf die Praxis verwiesen, Standorte der Bundeswehr nach Nazi-Offizieren zu benennen. Und es war die Zeit, als die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse einen Schmiss auf der Backe hatten, mithin schlagenden Verbindungen angehörten.
Alles beginnt an diesem Studioabend mit der Wirtschaft, natürlich im doppelten Sinne des Wortes, denn beides, die Nationalökonomie wie auch jener Ort, an dem man die Früchte der geleisteten Arbeit besaufen kann, ist elementar wichtig. Trixy Royeck hat dafür ein pfiffiges Bühnenbild hingestellt, ein Kneipeninterieur, das sich trotz karger Möblierung als modulationsfähig erweist.
Was sie allerdings dazu bewog, den gesamten vestimentären Fundus des Theaters auszuräubern, um eine weitgehend sinnfreie Kostümierung zu realisieren, erschloss sich nicht. Natürlich braucht man Roben, um die Verfassungsrichter einzukleiden, natürlich braucht man auch rote Stöckelschuhe und allerlei Putz, um aus einem Priester eine Dragqueen zu machen, doch der Rest ist ein wenig zu kunterbunt geraten. Aber na ja, wir sind halt im Karneval …
Sibylle Broll-Papes ideenreiche Inszenierung, beflügelt von Armin Breidenbachs rasanten dramaturgischen Einfällen, lässt der Langeweile an diesem Abend keine Chance, die sowieso blendende Performanz des kleinen Ensembles sowieso nicht. Wäre da nicht ein chronisches Problem: der Text. Er strotzt nur so vor repetitiven Wortspielen und anderweitigen Redundanzen, denen wirklicher Sprachwitz meist abgeht.
Darin verschwinden die guten Ideen zeitweise, so beispielsweise, wenn das ganze Arsenal an Spruchweisheiten durchgestöbert wird, die wie das unvermeidliche „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ für typisches Spießerdeutsch stehen. Fast wie ein Fremdkörper wirkt da die ernste Ansprache, die Magdalena Helmig gegen Ende anstimmt: Sozialkritik, Mahnung zur Solidarität. Nur kurz schlüpft man hier heraus aus der „Hanswurstiade“, die das Stück gemäß Untertitel ja auch sein will und seine klamaukigen Anwandlungen verständlich macht. Marek Egert, der seine Chamäleon-Rolle trotz Krankheit spielte und tapfer durchhielt, Stefan Herrmann und Eric Wehlan bildeten ein virtuoses Terzett, dem Magdalena Helmig ein sprudelnder Mittelpunkt war.