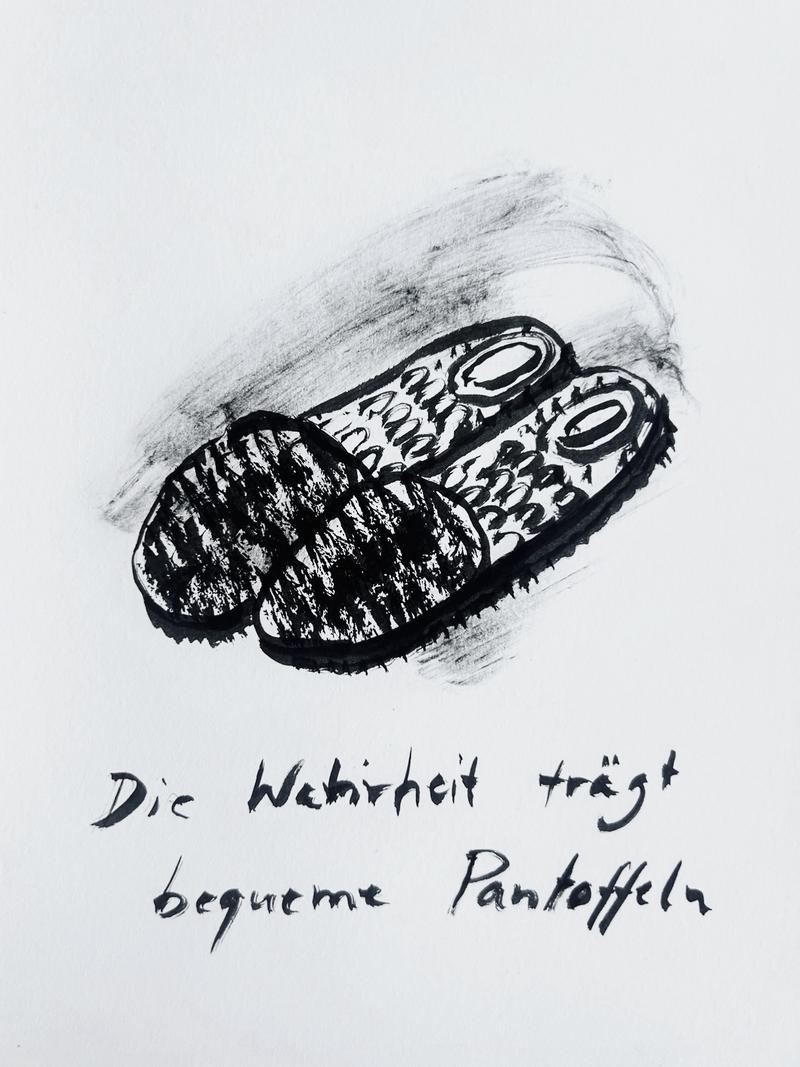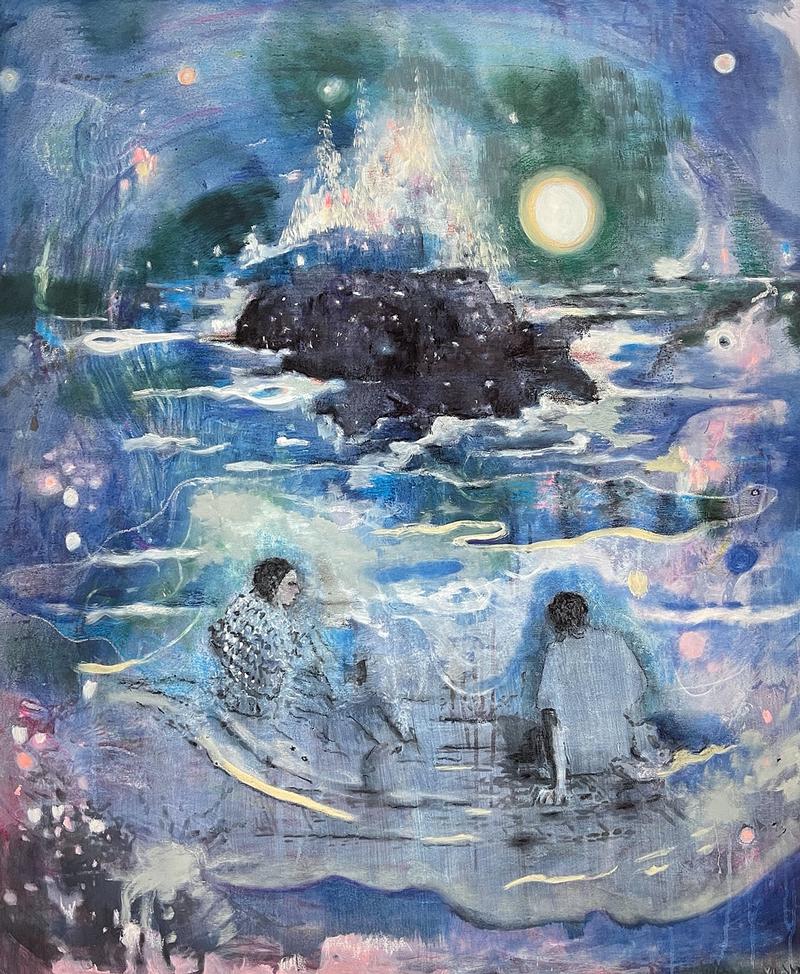Nora Gomringer liest beim Klagenfurter Wettstreit
Der 39. Ingeborg-Bachmann-Preis wird im Juli vergeben
veröffentlicht am 25.06.2015 | Lesezeit: ca. 9 Min.
Lange währte das Leben der Ingeborg Bachmann wahrhaftig nicht: gerade einmal etwas über viereinhalb Dekaden. Die starke Raucherin und hochgradig Tablettensüchtige war in einer Spätseptembernacht des Jahres 1973 in ihrem Zuhause in der Via Giulia 66 in Rom mit einer glimmenden Zigarette eingeschlafen. Es kam zu einem Zimmerbrand, Bachmann wurde in das Ospedale Sant‘ Eugenio eingeliefert, wo sie am 17. Oktober starb. Die behandelten Ärzte wussten nicht um Bachmanns Barbiturat-Abhängigkeit, sodass sie unter heftigen Entzugserscheinungen zu leiden hatte.
Alfred Grisel, der Bachmann freundschaftlich verbunden war, berichtet von den drei Wochen, die die Schriftstellerin im August in dem von ihm geleiteten Hilton Hotel auf Malta verbrachte: „Ich war zutiefst erschrocken über das Ausmaß ihrer Tablettensucht. Es müssen an die 100 Stück pro Tag gewesen sein, der Mülleimer ging über von leeren Schachteln. Sie hat schlecht ausgesehen, war wachsbleich. Und am ganzen Körper voller Flecken. Ich rätselte, was es sein konnte. Dann, als ich sah, wie ihr die Gauloise, die sie rauchte, aus der Hand glitt und auf dem Arm ausbrannte, wußte ich's: Brandwunden, verursacht von herabfallenden Zigaretten. Die vielen Tabletten hatten ihren Körper schmerzunempfindlich gemacht.“ (zitiert nach Peter Beicken, Ingeborg Bachmann. München: Beck, 2. Auflage 1992:213).
1964 war Bachmann der Georg-Büchner-Preis zuerkannt worden, mithin der bedeutendste Literaturpreis im deutschen Sprachraum. Seit 1977 wird sommers der zu ihrem Gedenken eingerichtete Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben, auch er eine hochrangige Auszeichnung. Erica Pedretti, Hermann Burger, Sten Nadolny, Wolfgang Hilbig und Birgit Vanderbeke, Alissa Walser und Uwe Tellkamp, 2007 Lutz Seiler, fünf Jahre später Olga Martynowa und zuletzt Tex Rubinowitz – der Wiener wird am 3. November zum Auftakt von „Bamberg liest“ im E.T.A.-Hoffmann-Theater seinen Roman „Irma“ vorstellen – zählen zu den Gewinnern des Wettlesens am Wörthersee. Der erste Preisträger überhaupt war 1977 der wie Bachmann in Klagenfurt geborene Gert Jonke.
Jonke las im Januar 2005 im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia, dessen Direktorin sich auf Einladung der FAZ-Kritikerin Sandra Kegel in diesem Jahr beim Klagenfurter Concours beweisen darf. Nora Gomringer sind seit 2003 über zwei Dutzend Preise, Stipendien, Poetikdozenturen zugesprochen worden. Den Anfang machte der Hattinger Förderpreis für junge Literatur, heuer ist sie mit dem Weilheimer Literaturpreis (7500 Euro) bedacht worden. Diese „Überförderung“ Gomringers wurde übrigens im April 2012 im Zürcher Tages-Anzeiger heftig kritisiert. Axel Kutsch, selbst Lyriker und, vor allem, Herausgeber von Lyrik-Anthologien, kleidete seine Verärgerung über das Preiskarussell in folgende Worte: „Es erinnert fast schon an absurdes Theater, wenn eine mittelmässige jüngere Poetin mit guten Beziehungen in diesem ach so menschelnden Betrieb innerhalb kurzer Zeit ein Dutzend Preise und Stipendien einheimst.“
Und der Verleger und Lyriker Anton G. Leitner konnte bei Gomringer, in der er immerhin eine „solide junge Lyrikerin mit einer starken Bühnenpräsenz“ erkennt, keine besonderen Verdienste um die Lyrik, welche eine Multiförderung erklären würden, ausmachen. Es gebe „Dutzende mindestens genauso begabter Autoren“, etwa Bas Böttcher, der „wesentlich mehr“ für die Lyrik leiste als Gomringer (und am gestrigen Mittwoch im Garten der Bamberger Villa Concordia beim Sommer Slam mitmischte), aber anders als diese „nahezu ohne Auszeichnung durchs Land“ ziehe.
Ende Mai begrüßte der Tages-Anzeiger gleichwohl den „Schweizer Boom in Klagenfurt“, denn außer Gomringer nehmen für die Schweiz Dana Grigorcea, Monique Schwitter, Jürg Halter und Tim Krohn am Bachmann-Wettbewerb teil. Dass Gomringer dabei ist, erstaunt insofern, als am Wörthersee bislang noch nicht publizierte Prosa vorzutragen ist, die Künstlerhausdirektorin aber so gut wie ausschließlich Gedichte veröffentlicht hat. Peter Truschner hingegen, der 2004/2005 Stipendiat der Concordia war, hat 2013 bei Zsolnay in Wien mit „Das fünfunddreißigste Jahr“ seinen dritten Roman vorgelegt und zudem Erzählungen und Reiseberichte publiziert.
Ähnlich lyrikaffin wie Gomringer ist unter den Kandidatinnen und Kandidaten wohl nur noch der Berner Dichter, Denker, Performancekünstler und (ehemalige) Rapper Jürg Halter. Er debütierte vor einem Jahrzehnt im feinen, leider nicht mehr existierenden Ammann Verlag; im vergangenen Jahr erschien im nicht minder feinen Göttinger Wallstein Verlag der sehr schöne Gedichtband „Wir fürchten das Ende der Musik“. Ebenfalls bei Wallstein kommt im August Anna Baars „Die Farbe des Granatapfels“ heraus. Baar, 1973 in Zagreb geboren, lebt in Klagenfurt und wurde 2012 mit dem Kärnter Lyrikpreis bedacht. Josef Winkler sagt im hymnischen Ton über den Band, er sei „keine Gegenwartsliteratur, sondern Zukunftsliteratur. Ein Roman-Sprachwerk sondergleichen.“
Und über Valerie Fritsch, 1989 in Graz geboren, sagt Winkler, der 1979 beim Bachmann-Wettbewerb den Sonderpreis (der damals mit Walter Jens, Joachim Kaiser, Hilde Spiel, Rudolf Walter Leonhardt, Heinrich Vormweg, Otto F. Walter und Marcel Reich-Ranicki noch fabelhaft besetzten) Jury erhielt: „Ich bin beglückt. Da kann man Gift oder Gegengift drauf nehmen, ich bin mir sicher, dass mit Valerie Fritsch ein Prosatalent in der österreichischen Gegenwartsliteratur aufgetaucht ist, von dem man noch viel hören wird.“ Fritsch ist unlängst mit dem mit 10 000 Euro ausgestatteten Peter-Rosegger-Literaturpreis ausgezeichnet worden, denn ihr Werk sei „ein Fest der Sprache und ihr Erscheinen auf der Bühne der deutschsprachigen Literatur ein Grund zur Feier. Melancholie und Lebensfreude, Verfall und Blüte, Tod und lebendiger Wildwuchs greifen in ihren Sätzen ineinander. Ihre Prosa ist furchtlos, stilvoll und dem ewigen Rätsel der Welt verschrieben.“ Die Probe machen kann man durch die Lektüre von Fritschs im März von Suhrkamp herausgebrachten Roman „Winters Garten“.
Saskia Henning von Lange, Falkner (das ist die ihre Arbeit als Gesamtkunstwerk verstehende Wienerin Michaela Falkner; sie veröffentlich „weder Beiträge, noch Bücher oder Hörspiele – sondern Manifeste, mit Nummern versehen eine Art Welt- und Sehnsuchtsformel in mittlerweile 49 Teilen), die gebürtige Linzerin Teresa Präauer, die auch als bildende Künstlerin wirkt, was sich in ihrem zweiten, in der Kunstszene von heute angesiedelten Roman „Johnny und Jean“ spiegelt (Göttingen: Wallstein, 2014; nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und ausgezeichnet mit dem Droste-Förderpreis sowie dem Hölderlin-Förderpreis 2015), Katerina Poladjan – sie wurde 1971 in Moskau geboren, ist Autorin des Ende August bei Rowohlt Berlin erscheinenden Romans „Vielleicht Marseille“ und Schauspielerin – Ronja von Rönne, dreiundzwanzig Lenze alt und sich als Frau vom Feminismus angeekelt fühlend, und Sven Recker, dessen gerade mal um die 128 Seiten starker Debütroman „Krume Knock Out“ im August in der Edition Nautilus erscheint, heißen die übrigen Klagenfurt-Kandidaten.
Den Vorsitz der siebenköpfigen Jury hat erstmals Hubert Winkels inne, der darin Burkhart Spinnen nachfolgt. Jedes Mitglied durfte zwei Schriftsteller zum Wettbewerb bitten. Auch wenn aus Gründen der Kostenersparnis in diesem Jahr der mit 7500 Euro dotierte 3sat-Preis weggefallen ist, bleiben mit dem mit 25 000 Euro ausgestatteten Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt, mit dem Kelag-Preis (10 000 Euro), mit dem Ernst-Willner-Preis (5000 Euro) und dem BKS-Bank-Publikumspreis, dessen Gewinner(in) sich auf 7000 Euro freuen darf, noch genügend Auszeichnungen, um welche die Teilnehmer wetteifern können.
Die 39. Tage der deutschsprachigen Literatur finden vom 1. bis zum 5. Juli statt. Neben dem renommierten Wettbewerb finden sich noch etliche weitere Veranstaltungen im Programm, beispielsweise ein Literaturkurs für Nachwuchsautoren, ein „Evergreens of Psychoterror“ überschriebener Abend, bei welchem Tex Rubinowitz und DJane Commander Venus spontan rare Singles auflegen werden, ein Bachmann Song Contest und – bereits am kommenden Samstag, den 27. Juni, im Musil-Institut zu Klagenfurt – die „Reden über Ingeborg Bachmann“. Peter Hamm wird über den Briefwechsel zwischen Hans Werner Henze und dessen „lieben armen kleinen Allergrößten“, also Ingeborg Bachmann, sprechen. Das dürfte ein ganz wunderbarer Abend werden. Für Hamm zeichnet diese Briefe aus, dass man Bachmann „so nahe kommt wie nie zuvor und dabei zugleich stets die ungeheure Entfernung ermisst, die uns von ihr trennt“.
Ohne die enge Freundschaft zwischen Bachmann und dem homosexuellen Henze wäre beispielsweise – und hier schließt sich der Kreis zu dem eingangs erwähnten Festival „Bamberg liest“ und auch zu Nora Gomringer – das (Henze eben zugeeignete) Gedicht „Enigma“ nicht geschrieben worden. Bachmanns „Enigma“ sowie fünf weitere Gedichte werden bei dem Bamberger Literaturfestival in einem Lyrik(t)raum neben Gomringers Lyrikband „Morbus“ interaktiv, interdisziplinär und multimedial vorgestellt. Man merke sich die Vernissage am 7. November um 19 Uhr schon einmal vor. Und zu Peter Hamm sei abschließend noch gesagt, dass wir ihm unter anderem „Welches Tier gehört zu dir?“ (München: Hanser, 1984) verdanken, eine von dem Tierarztsohn Hamm errichtete poetische Arche Noah, deren Lektüre große Freude bereitet. Ein ums andere Mal.
Valerie Fritsch © Jasmin Schuller
Anna Baar © Johannes Puch
Teresa Präauer © Katharina Manojlovic
Nora Gromringer © Jürgen Bauer
Katerina Poladjan © Christine Fenzl
Jürg Halter © Eva Günter
Peter Truschner © Stefan Schweiger
Hubert Winkels © Brigitte Friedrich
Ingeborg Bachmann © ORF