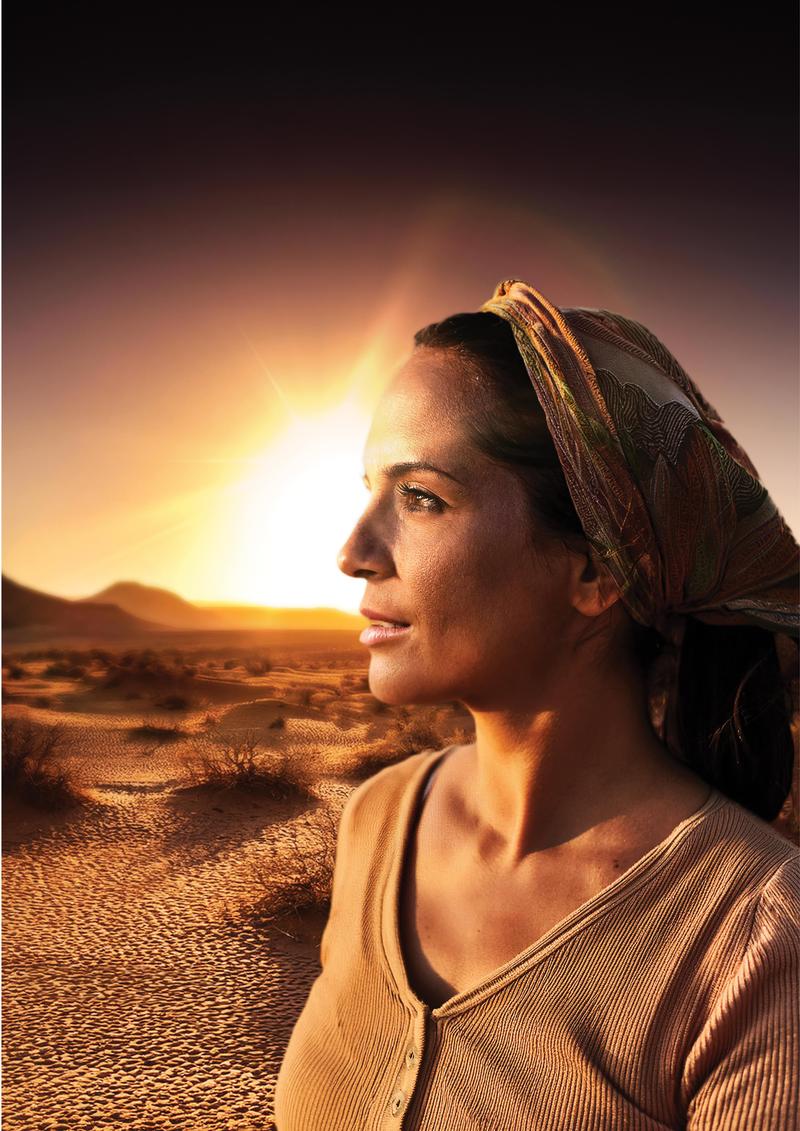Zur Uraufführung von Konstantin Küsperts Stück „rechtes denken.“
Ein Gespräch mit der Regisseurin Julia Wissert
veröffentlicht am 09.10.2015 | Lesezeit: ca. 11 Min.
Mit einunddreißig Jahren ist sie noch sehr jung, hat aber doch schon etliche Erfolge auf den Theaterbühnen zwischen Oldenburg, Celle, Göttingen, Wiesbaden und dem Münchner Residenztheater verbuchen dürfen. In Bamberg inszeniert Julia Wissert zum Spielzeitauftakt Konstantin Küsperts Stück „rechtes denken.“, das im Studio des E.T.A.-Hoffmann-Theaters am 18. Oktober zur Uraufführung kommen wird. Wissert, vor Esprit sprühend und voller Schlagfertigkeit, nahm sich die Zeit zu einem Gespräch mit Ludwig Märthesheimer und Jürgen Gräßer.
ART. 5|III: Zunächst einmal, liebe Frau Wissert, herzlichen Dank dafür, dass Sie zu einem Gespräch bereit waren und die Zeit dafür gefunden haben.
Julia Wissert: Selbstverständich!
ART. 5|III: Nun, Sie stecken schließlich inmitten der Vorbereitungen einer Uraufführung, Konstantin Küsperts „rechtes denken.“, und sind wirklich im Stress. Ist das Ihre erste Inszenierung für Frau Broll-Pape? Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen? Hat man bei Ihnen angefragt? Kannten Sie einander?
Julia Wissert: Nein, wir kannten uns nicht. Was eigentlich ganz interessant ist, weil nämlich, nachdem ich dann erzählt habe, dass ich für Frau Broll-Pape arbeiten würde, herauskam, dass meine Mentorin an der Uni schon ganz lange mit ihr befreundet ist, weil die beiden in einer Generation Regisseurinnen sind, die jetzt noch arbeiten und die davon leben können. Ich glaube, das ist die dritte Generation von Regisseurinnen, die rausgekommen ist, nach Andrea Breth. Und da gibt es eben Amélie Niermeyer, Sibylle Broll-Pape, dann kommen Karin Henkel, Karin Beier. Aber das ist fast schon wieder eine neue Generation.
ART. 5|III: Man hat Sie also angefragt?
Julia Wissert: Man hat mich angefragt. Frau Broll-Pape und ihr Dramaturg, Herr Al Khalisi, sind nach Wiesbaden gefahren, nachdem ich den Kurt-Hübner-Regiepreis erhalten hatte, und haben sich das Stück [„Der Junge in der Tür“ von Juan Mayorga] angeschaut. Gleichzeitig wurde ich noch von einem Dramaturgen, den Herr Al Khalisi kannte, empfohlen. Ich sei eine sehr nette Person und mache eine ganz hervorragende Arbeit.
ART. 5|III: Ist das wesentlich? Das mit der netten Person?
Julia Wissert: Für mich ist es tatsächlich wichtig, und meinen KollegInnen auch. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Aber ich finde es schon wichtig, wenn man sechs Wochen eine intensive Zeit miteinander verbringt, dass es Spaß macht zwischendurch, besonders, wenn man sich die sechs Wochen mit Nazis und rechtem Denken beschäftigt. Mit ist es ein Anliegen, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre gibt.
ART. 5|III: Sie haben vorhin, als Sie über die Regisseurinnen der anderen Generation gesprochen haben, in einem Nebensatz gesagt: „und davon leben können“?
Julia Wissert: Ja, weil ich sagen würde, also Frau Niermeyer kann, glaube ich, ganz gut davon leben. So wie sie mir das erzählt hat, gab es in ihrer Generation mehr Frauen, die angefangen haben, die aber jetzt keine Regie mehr machen. Und auch im Kontakt mit Dramaturgen wurde mir einmal erzählt dass es in den nächsten vier Jahren wohl den ersten Bruch gibt bei den Frauen, so mit 35, dass die ersten ausscheiden aufgrund von persönlichen Entscheidungen, und dass imgrunde die wichtigen Jahre wohl die ersten drei, vier Jahre sind. Und dann, wenn man sich da reingearbeitet hat, kann es passieren, dass irgendwann nochmal ein Bruch kommt, wenn dann die Dramaturgen, mit denen man großgeworden ist, entweder alle weggehen, etwas anderes machen oder Intendanten werden.
ART. 5|III: Das führt uns zu einer Frage, die wir eigentlich erst am Ende stellen wollten. Wie ist es um Ihre Zukunft bestellt? Wo sehen Sie sich in, sagen wir, zehn Jahren? Sie sind ja bereits recht erfolgreich.
Julia Wissert: In zehn Jahren? Es läuft ganz gut, würde ich mal sagen. Klar, in der ersten Spielzeit den Kurt-Hübner-Preis zu bekommen, das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist ein Riesengeschenk. In zehn Jahren wäre ich wahnsinnig gerne Mitglied eines Intendantenteams eines größeren Hauses irgendwo im deutschsprachigen Raum, hätte ein diverses Ensemble und würde meine MitarbeiterInnen sehr gut bezahlen können und stünde in regem Austausch mit der Stadt und der Region, in der und für die wir Theater machen. Und es wäre gutes Wetter und die Sonne würde scheinen und alle wären glücklich. Und alle Kulturpolitiker fänden mich fantastisch.
ART. 5|III: Als Sie Schauspieler mit gutem Geld in Zusammenhang brachten, wussten wir schon, dass es in Richtung Traum geht.
Julia Wissert: Ja, vielleicht ein Traum. Aber es ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, zu schauen, wie Häuser mit ihren MitarbeiterInnen umgehen und auch, wie man diesen, was er ja letzten Endes ist, extrem hierarchischen Betrieb, der über Vetternwirtschaft und Empfehlungen und gute Tricks auch läuft, verändern kann, so dass man gut oder besser darin arbeiten kann. Manchmal gibt es Situationen, wo ich mir denke: Es ist schon komisch, dass ich dafür eingestellt werde, für eine Stadt Theater zu machen und meine Idee von Realität in eine Stadt zu setzen, wobei ich doch gleichzeitig durch meine Arbeitsbedingungen gar nicht an dieser Realität teilnehmen kann. Wir arbeiten ja von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr. Wir sind nicht in Sportvereinen, meine Zeitung lese ich auf dem Tablet.
ART. 5|III: Warum, für Sie, Theater?
Julia Wissert: Mich interessiert Form, mich interessiert, wie man Theater als einen politischen Körper benutzen kann, wie man diese Hierarchie aufbrechen kann. Ich glaube nicht daran, dass ein Schauspieler weniger kompetent ist, nur weil er weniger Auseinandersetzung mit einem Text hat.
ART. 5|III: Aber da Sie sich in einer subventionierten Landschaft befinden, in der politische Einflussnahme gerade bei kommunalen Häusern sicherlich gegeben ist, wird dies nicht ganz einfach sein, oder?
Julia Wissert: Es machte ja nur halb so viel Spaß, wenn es einfach wäre. Erstens das. Und zweitens ist meine Vermutung, dass sich – was man ja schon beobachten kann – das Theater, so wie es jetzt ist, nicht mehr hundert Jahre halten kann. Und dieser Elfenbeinturm, der, wenn man polemisch sprechen würde, ja wirklich ein mittelalter heterosexueller weißer Mann ist, auch nicht mehr der Lebenswirklichkeit von allen anderen entspricht. Also ich finde es uninteressant, dumme Frauen auf der Bühne zu sehen, die starken Männern ihre Unterstützung geben, damit sie die Welt retten können, und am Ende sterben sie. Ich habe aber auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, das anders zu inszenieren. Allerdings könnte ich nicht morgens zur Arbeit gehen, wenn der Versuch nicht immer wäre, irgendetwas zu verändern oder zu schauen, wie man Wirklichkeit, so wie sie jetzt ist, irgendwie reinholen kann. Das werden Sie ja sehen, wenn Sie „rechtes denken.“ sehen, was da der Versuch ist.
ART. 5|III: Das Ensemble besteht ja zu großen Teilen aus neuen Leuten. Es muss sich erst kennenlernen, ist wohl noch kaum aufeinander eingespielt. Spüren Sie das?
Julia Wissert: Schön, dass Sie danach fragen. Ich habe am zweiten Tag eine SMS bekommen von einem der Schauspieler, der mit mir arbeitet, in der stand: „Ich habe nicht das Gefühl, dass es erst der zweite Tag ist, den wir zusammenarbeiten.“ Er hatte das Gefühl, wir seien schon seit fünfzig Jahren zusammen, wir machten schon seit fünfzig Jahren Theater. Das empfand ich als ein wahnsinniges Kompliment. Am zweiten Tag sind wir nackt in Tierkostümen über die Bühne gerannt und haben Musik gemacht und Schlager gesungen. Und auch die Vier untereinander, die auf der Bühne stehen: In keiner Sekunde würde ich annehmen, dass die sich nicht kennen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dies die erste Woche ist. Es war schon krass! Es ist wirklich ein fantastisches Arbeiten gerade, obwohl es um Nazis geht.
ART. 5|III: Seit wann proben Sie?
Julia Wissert: Heute ist der dritte Tag. Wir hatten aber Ende Juli schon fünf Tage vor den Theaterferien. Also acht Tage, und wir sind imgrunde fertig!
ART. 5|III: Spüren Sie so eine Art Aufbruchstimmung im Ensemble, ja im ganzen Haus?
Julia Wissert: Ja! Sogar nicht nur im Haus. Ich wurde letztens im Luitpold-Café angesprochen, ich glaube, vom Besitzer. Er meinte, er freue sich total auf frischen Wind in der Stadt. Anscheinend hat sich die Aufbruchstimmung schon weiter verbreitet als lediglich im Haus.
ART. 5|III: Auf Demonstrationen ist derzeit wieder zu erleben, dass das rechte Denken doch recht vielen Menschen hierzulande, auch in Oberfranken, nicht fremd ist. Insofern ist Küsperts Stück sicherlich hochgradig aktuell. Was kann das Theater, was kann gerade auch das Bamberger Haus tun, um sich für Freiheit, für ein friedliches Miteinander, für Demokratie stark zu machen?
Julia Wissert: Wow, okay! Das ist natürlich eine Frage! Ich würde jetzt eher aus dem „rechten denken.“ heraus argumentieren. Konstantin Küspert versucht imgrunde, die Komplexität des Themas im Theater spürbar ästhetisch zu übersetzen, sodass es wegkommt von etwas Theoretisch-Diskursivem hin zu etwas, was versinnlicht wird. Sein Stück ist nicht ganz einfach, auch im Aufbau nicht und dem, was Küspert will. Sein Anspruch ist es tatsächlich, die Welt zu verbessern. Was mir wichtig wäre an einem Theater ist, dass es sich klar positioniert zu politischen Bewegungen innerhalb der Stadt und Region, in der das Theater verankert ist. Es ist wichtig, dass man sagt, dass man künstlerisch im Austausch steht mit BürgerInnen, dass man eine Haltung beziehen muss und dass man irgendwie sagen muss: Das denken wir, und ihr könnt euch dazu verhalten und mit uns in den Dialog treten. Das würden wir uns wünschen.
ART. 5|III: Es wird, im Gewölbekeller, Einführungen geben.
Julia Wissert: Das freut mich. Dieses Stück ist so kompliziert und komplex. Wenn man zum ersten Mal drin sitzt, könnte ich mir vorstellen, dass man erst einmal denkt: „Wow!“ Es kommen so viele Informationen und Ideen, der Versuch ist so groß! Auch den Schauspielern ist es ein Anliegen, dass es Vor- oder Nachgespräche gibt, weil sie sagen, wenn man das sieht, denkt man vermutlich, wir seien verrückt. Sie sagen: „Wir sind dazu da, um mit euch darüber zu sprechen, was ihr gesehen habt, wo es für euch funktioniert hat, wo ihr denkt, es ist total falsch.“ Das, finde ich, wäre die Aufgabe eines Theaters.
ART. 5|III: Diese Komplexität wäre ja auch ein Grund, dass sich das Publikum das Stück zweimal anschaut.
Julia Wissert: Man kann sich das Stück dreimal anschauen. Es gibt drei unterschiedliche Positionen, wo man sitzen kann und von denen aus man unterschiedliche Dinge sehen kann.
ART. 5|III: Das nimmt eine Frage vorweg. Was zeichnet Ihre Inszenierung aus? Warum sollten die Bamberger sich gerade „rechtes denken.“ anschauen?
Julia Wissert: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich natürlich meine eigenen Arbeiten auf dieser Ebene überhaupt nicht reflektieren kann. Jedenfalls fällt es mir wahnsinnig schwer. Außerdem bin ich ja imgrunde noch eine Anfängerin. Alle Arbeiten, die ich in den vergangenen anderthalb Jahren produziert habe, sind komplett unterschiedlich. Formal, inhaltlich. Einen gemeinsamen Nenner gibt es: Form und Körper sind mir sehr wichtig. Mich interessiert Theater nicht als Raum, der die Wirklichkeit reproduziert, sondern als Raum, der eine Möglichkeit von Hyperästhetisierung oder Verdichtung bietet, um einen Verweis auf etwas in der Wirklichkeit zu schaffen.