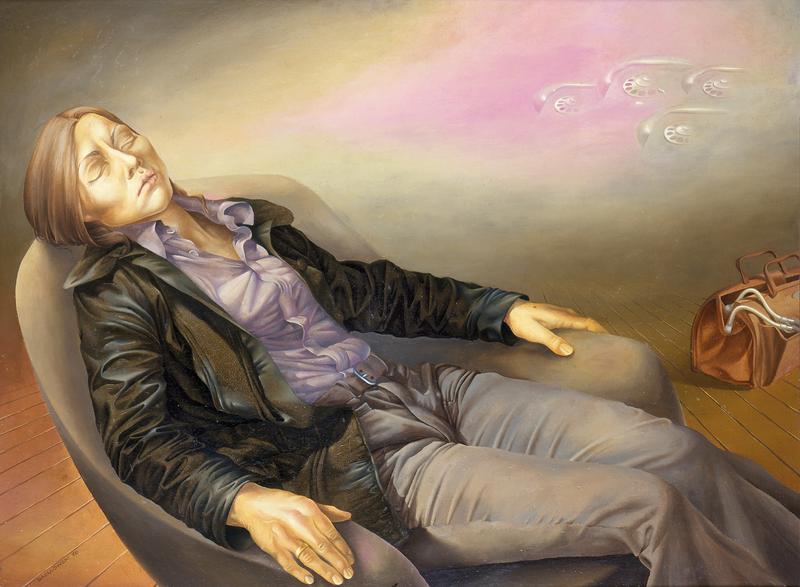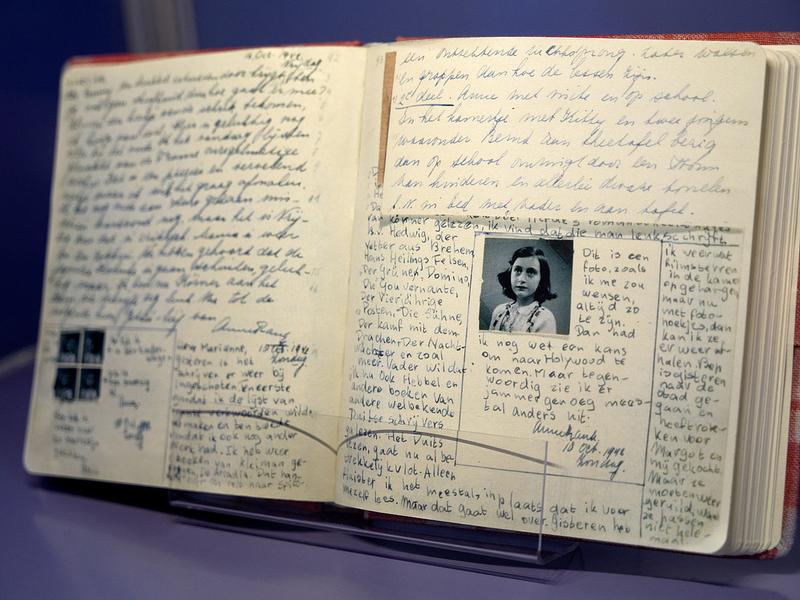Auf den kostbaren Spuren der sächsischen Kurfürsten
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Teil 1)
veröffentlicht am 02.06.2017 | Lesezeit: ca. 10 Min.
„Blühe, Deutsches Florenz, mit Deinen Schätzen der Kunstwelt!“, rief Gottfried Herder 1802 aus. Und auch heute liegt Dresden märchenhaft in seinem Elbtal und wartet nur darauf, all seine Kunstschätze zu offenbaren. Diese haben in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ihre Heimat gefunden, die aus den 1560 begründeten Sammlungen der sächsischen Kurfürsten und polnischen Könige hervorgehen und 14 Museen zählen, welche zu den bedeutendsten der Welt gehören. Eine einzigartige thematische Vielfalt präsentiert sich dem Besucher im Elbflorenz. So lädt der Zwinger nach dem Passieren im Innenhof gelegener verzückender Wasserspiele in eine filigrane Welt aus Porzellan ein und beeindruckt mit der qualitätsvollsten und zugleich umfangreichsten keramischen Spezialsammlung der Welt. Herausragend nehmen sich dabei frühe Bestände der Meißner Porzellankunst wie auch ostasiatische Porzellane des 17./18. Jahrhunderts aus. Dieses 20.000 Objekte umfassende Kostbarkeitenkabinett ist der Porzellansucht August des Starken, seiner „maladie de porcelaine“, zu verdanken. Sie stellt jedoch nicht sein einziges Interessengebiet dar, auch wissenschaftliche Instrumente faszinierten den Kurfürsten. So entstand im Jahre 1728 der Mathematisch-Physikalische Salon, der eines der weltweit bedeutendsten Museen dieses Fachgebietes verkörpert und ebenfalls im Zwinger beheimatet ist. Exponate des 16.-19. Jahrhunderts, die allesamt der wissenschaftlichen Bestimmung der Welt dienten, gilt es hier zu bestaunen: Brennspiegel, historische Uhren, Teleskope sowie Globen. Als besonderen Höhepunkt können Besucher historische Experimente mit detailgetreu nachgebauten Instrumenten erleben.
Ihre Verwunderung sollte auf diese Weise jeden Begriff übersteigen, so wie Goethe es damals empfand, als er den Semperbau besuchte, die Gemäldegalerie Alte Meister betrat und durch eine imposante Säulenhalle mit goldumranktem Deckengewölbe wandelte, die heute Altar- und Andachtsbilder bereithält. Ein Parcours hochrangiger Gemälde aus dem Spätmittelalter bis zur Aufklärung beginnt im Erdgeschoss zunächst mit paradiesischen Darbietungen Cranachs des Älteren wie auch van Eycks. Wendet man den Blick von Parmigianino ab, wird man Tizians „Bildnis einer Dame in weiß“ gewahr, deren blondes Haar und gerötete Wangen mädchenhaft-idealistisch wirken. Ihr firmer und doch unschuldiger Blick ist kaum einzufangen, führt dieser doch zielgerichtet am Betrachter vorbei an die gegenüberliegende Wand zu Tintorettos „Bildnis einer Dame in Trauer“, welches mit seiner dunklen, ernsten Farbgebung einen herausfordernden Kontrast zu der blühenden Schönheit der Portaitierten Tizians bildet. Ein Stockwerk darüber findet sich sodann die Abgusssammlung des Dresdner Hofmalers Anton Mengs, welche primär Abgüsse nach antiken Plastiken beinhaltet. Diese Werke passierend sind an den herrschaftlich dunkel gehaltenen Wänden Höhepunkte des Schaffens renommiertester Künstler wie Poussin, El Greco, Rembrandt sowie Velazquez zu erblicken, bis schließlich der Rubenssaal folgt. Hohe Wände voller Darstellungen lebensnaher Portraits und virtuoser Gruppenbildnisse. Wie ein Kirchenschiff nimmt sich der längliche Saal beinahe aus. Und mit seiner Durchquerung verstärkt sich dieser Eindruck, schreitet man doch auf das Herzstück der kurfürstlich-sächsischen Kunstkammer zu, welches wie ein Altar, umrahmt von Gold, über dem Besucher thront: Raffaels „Sixtinische Madonna“. Verträumt lächelnd stützen die weltberühmten Engel am Bildgrund ihre Lockenköpfe auf ihre kleinen Hände, beinahe unberührt von dem Geschehen über ihnen, das in einer numinosen Dreieckskomposition die Madonna mit einem Kind auf dem Arm und sie flankierend Papst Sixtus II. sowie die Heilige Barbara zeigt. Dem Meisterwerk gelingt es zweifelsohne, den Betrachter mit seiner allumfassenden Ruhe und zeitgleichen Dynamik, dem imposanten Format und der beeindruckenden Virtuosität in Farbgebung und Pinselführung in seinen Bann zu ziehen. Überwältigt von solch himmlischer Schönheit, bleibt kaum Zeit, innezuhalten, warten doch im nächsten Stockwerk bereits malerische Veduten Canalettos, deren maritime Farben und von Wind aufgewühlte Kanäle eine wahrhaftige Italien-Sehnsucht auslösen. Diese lässt sich zumindest ein wenig im Skulpturenrundgang lindern, der Renaissance- und Barockschätze bereithält und mit Werken Filaretes, aber auch Permosers, seines Zeichens Schöpfer des Skulpturenschmucks am Zwinger, sowie Heermanns auftrumpft. Beide Ausstellungen zusammen belegen, welch wichtige Inspirationsquelle die antike Skulptur in Renaissance und Barock für Malerei und Plastik darstellte.
Eine vergleichbare Symbiose setzt sich im Albertinum fort, welches man in wenigen Gehminuten, die Frauenkirche passierend, erreicht. Die zuletzt betrachteten Veduten Canalettos werden hier durch die pittoresken Landschaften Caspar David Friedrichs abgelöst, der in der Galerie Neue Meister die Moderne einläutet. Weitere Romantiker wie Ludwig Richter folgen, und die namhaftesten Vertreter sich anschließender Epochen wie Monet, Corinth und Slevogt für den Impressionismus, die Brücke-Künstler für den Expressionismus und Dix für die Neue Sachlichkeit. Schließlich spannt sich der Bogen bis zur Gegenwartskunst, die so typisch gepunktete Werke Sigmar Polkes sowie farbenfroh-grelle Arbeiten Günter Fruhtrunks bereithält, und endet mit einem ungleich bekannteren Richter: Gerhard, der eigens zwei Säle im Albertinum gestaltete, die einen auserwählten Einblick in sein Œuvre von den Photomalereien der 1960er-Jahre bis hin zu den aktuellen abstrakten Gemälden liefern. Über diese zwei Räume hinaus zeigt das Albertinum bis zum 27. August „Neue Bilder“ des Künstlers, 2016 entstandene abstrakte Gemälde, die durch ihre leuchtende Vielfarbigkeit, die einzigartige Richter‘sche Pinselführung sowie den präzisen Einsatz von Rakel, Spachtel und Holzstiel seiner Pinsel einmal mehr den Status Richters als einen der renommiertesten lebenden Künstler bekräftigen. Eine weitere Sonderausstellung widmet sich bis zum 23. Juni der „Ganz konkret[en]“ Kunst Karl-Heinz Adlers, der sich besonders auf Collagen spezialisiert. Überdies beherbergt das Albertinum eine beeindruckende Skulpturensammlung, welche bei Rodin, der vornehmlich die Plastik in das Zeitalter der Moderne überführte, beginnt und ferner Werke aus mehr als fünf Jahrtausenden von der Antike bis zur Gegenwartskunst umfasst.
Von kostbaren Plastiken zu wahrlich kostbarer Handwerkskunst sind es nur wenige Schritte in Richtung des imposanten Residenzschloss. Im Vorgarten blüht der Flieder frühlingshaft und betritt man erst den lichtdurchfluteten, königlichen Gebäudekomplex, fühlt man sich wie August der Starke selbst: gekommen, um den Glanz der eigenen Schätze einmal mehr erstrahlen zu sehen. Tatsächlich beherbergt das hier gelegene Grüne Gewölbe die umfassenden Schätze des Kurfürsten, wobei das Historische Grüne Gewölbe eine Rekonstruktion der Schatzkammer bildet. Umsäumt von verzierten Wänden, in barocker Manier auf vergoldeten Konsolen präsentiert, finden sich hier Meisterwerke der Juwelier- und Goldschmiedekunst. Um die Authentizität einer Schatzkammer zu wahren, werden die Objekte ohne Vitrinen inszeniert, sodass nur Besucher mit zuvor erworbenen Tickets Einlass erhalten. Spontanen Interessenten bleiben die Besitztümer Augusts jedoch nicht verwehrt, gibt es doch das Neue Grüne Gewölbe, welches Schatzkunst aus drei Jahrhunderten zeigt: Preziosen aus Gold, Edelsteinen, Perlmutt und Straußeneiern warten in spiegelfreien Vitrinen, von modernster Lichttechnik in Szene gesetzt. Dabei offenbaren sich auch die winzigsten handwerklichen Feinheiten, so bei einem besonderen Stellvertreter der Mikroschnitzkunst: einem Kirschkern, den 185 Angesichter zieren.
Zu betrachten gilt es im Residenzschloss überdies die Rüstkammer, die zu den kostbarsten Prunkwaffen- und Kostümsammlungen weltweit zählt, die Türckische Cammer, welche als eine der ältesten Sammlungen osmanischer Kunst außerhalb der Türkei gilt, wie auch das Kupferstichkabinett, das Werke namhafter Künstler aus acht Jahrhunderten von Dürer bis Baselitz beheimatet.
Doch damit erschöpft sich die Vielfalt der SKD noch lange nicht. So zeigt die Kunsthalle im Lipsiusbau Malerei, Graphik und Skulptur des 20./21. Jahrhunderts und präsentiert bis zum 25. Juni „You May also like: Robert Stadler“, eine Überblicksausstellung des Künstlers, der an der Schnittstelle zwischen Design und bildender Kunst arbeitet. Überdies erwartet den Besucher im 1875 gegründeten Museum für Völkerkunde im Japanischen Palais eine international bedeutende Sammlung außereuropäischer Kunstwerke in faszinierender Qualität. Herausragend nehmen sich dabei Objekte wie die geschnitzten und bemalten Hausbalken eines Männerklubhauses von den Palau-Inseln aus, deren kolorierte Flachreliefs mythische und erotische Themen in einer naiv-unschuldigen und dabei so fortschrittlichen Manier zeigen, dass die im Albertinum zu bewundernden Brücke-Künstler diese Objekte als Inspirationsquelle nutzten und es Pechstein vor lauter Verzückung sogleich auf die Palau-Inseln verschlug.
Eine andere Art naiver Kunst befindet sich im Jägerhof, der das Museum für Sächsische Volkskunst mit Puppentheatersammlung beherbergt. In der stimmungsvollen Kulisse des 400 Jahre alten Baus bietet sich dem Besucher ein abwechslungsreicher Einblick in die faszinierende Welt der Volkskunst aus den Grenzbereichen zwischen Alltagsleben und Kunst. Wem der Sinn nach noch mehr kunstvollen Alltagsgegenständen steht, sei ein Besuch im Sommerschloss Pillnitz angeraten. Hier residiert, idyllisch zwischen Elbe und Weinbergen gelegen, das 1876 gegründete Kunstgewerbemuseum, welches eine vielfältige Sammlung angewandter Kunst und Design von der Antike bis zur Gegenwart präsentiert.
Für diese mannigfache und exquisite Auswahl an hochkarätigen Meisterwerken könnten Sie tatsächlich einige Tage brauchen. Aber: Weshalb auch nicht?
…Fortsetzung folg: In der nächsten Ausgabe lesen Sie Teil 2:
Das Alte Dresden - Ein Überblick über Dresdens Museumsarchitektur
Fotocredits:
Residenzschloss Dresden, Foto © David Brandt
Porzellansammlung, Dresdner Zwinger, Baldachin nach chinesischem Vorbild, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto © Jürgen Lösel