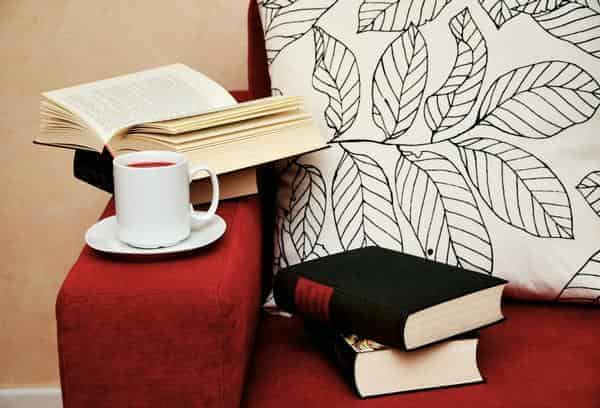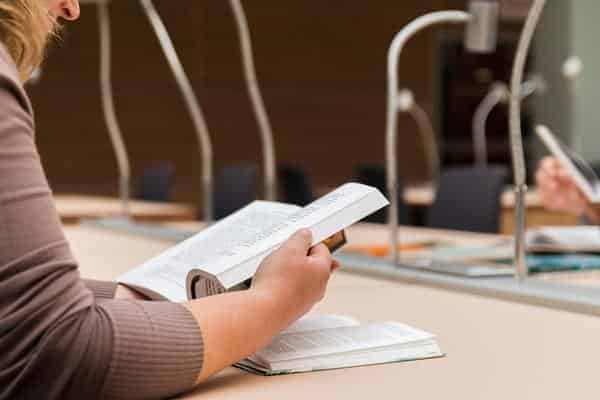Dem Vater des Konkreten
Eugen Gomringer zum Neunzigsten
veröffentlicht am 26.11.2014 | Lesezeit: ca. 9 Min.
Was unmittelbar überrascht, ja, was Staunen macht, sofort, ist diese Lebendigkeit (in der Stimme, der Mimik, in den Augen), auch der Humor, die Spontanität, die Wortgewandtheit – und er hat viel zu erzählen – sowieso. Immerhin wird dieser Mann im Januar neunzig Jahre alt. Dieser Mann? Eugen Gomringer ist unser Mann. Zumindest „Zur Sache des Konkreten“.
So nämlich heißt der dritte Band der Gomringer geltenden Gesamtausgabe, die seit einem Jahrzehnt in Wien bei der Edition Splitter erscheint. Tatsächlich wird der am 20. Januar 1925 in Cachuela Esperanza/Bolivien als Sohn einer Bolivianerin und eines Zürcher Kaufmanns Geborene als „Vater der konkreten Poesie“ gefeiert, von Emmett Williams, der 1967 in einer maßgeblichen Anthologie die Konkreten versammelt und vorstellt. „Gott sei Dank hat er das gesagt“, sagt der dazu befragte Gomringer selbst.
Karl Riha, der lange in Siegen lehrende Literaturwissenschaftler und Autor, nennt den um just zehn Jahre Älteren gar den „Vater der deutschen Nachkriegsmoderne“, und holt aus: „Dies gleichermaßen durch programmatische Verlautbarungen wie extraordinäre poetische Texte, die bis heute – und über das Heute hinaus – ihre Spannkraft behalten haben. Er ist – im technischen wie im imaginativen Sinne des Begriffs – ein Erfinder, der die Sprache der Literatur nachhaltig verändert hat.“
Die entscheidende Konfrontation, die Gomringer auf die Spur der Konkreten Poesie brachte, war nicht die mit Literatur, sondern die mit bildender Kunst. Im Frühjahr 1944 zeigte die Kunsthalle Basel Werke von Jean Arp, von Walter Bodmer, Richard Paul Lohse, Piet Mondrian und Max Bill, auf dessen Bilder Gomringer bereits in Zürich getroffen war, dessen Sekretär an der Hochschule für Gestaltung in Ulm er von 1954 bis 1957 werden sollte. Diese „begegnung mit der konkreten kunst“, so der konsequent kleinschreibende Gomringer, sei „bestimmend für eine neuorientierung von form und funktion sprachlicher kunst“ gewesen. Die „konkrete poesie“ habe, „wie allgemein bekannt, ihre bezeichnung der kunst entliehen“, die ihr wiederum „mit ihren ‚vorbildern‘ um jahre voranging“.
Die Mehrsprachigkeit im gesprochenen wie im geschriebenen Wort hat Gomringer von Anfang an begleitet: Das Spanische der Mutter, das noch heute bei ihm durchschlagende Schweizerdeutsch, genauer: Züritüütsch, des Vaters, bald das Englische, das man untereinander zuhause sprach, das Französische (auch über die Maigret-Romane von Simenon), das Italienische (in Rom bewunderte er Bernini, Borromini, Michelangelo). Konsequenterweise hieß Gomringers erstes konkretes Gedicht 1951 „avenidas“ (Alleen), die erste Gedichtsammlung der Konkreten Poesie, zwei Jahre hernach in Bern erschienen, „konstellationen constellations constelaciones“.
Der sinnliche Reiz dieser Sprachkunstwerke aus meist auf einer einzigen Buchseite „in überlegter, optisch sinnfälliger Weise angeordneten Einzelwörter“, die sich „auf spielerische Weise miteinander in Beziehung“ (Volker Meid) setzen lassen, geht nicht, wie etwa bei Gedichten Georg Trakls oder Stefan Georges, von Assoziationen oder Metaphern aus. Es ist die Sprache selbst, die plötzlich strahlt, das Wort an sich, auch in Beziehung zu den jeweils noch die Konstellation schaffenden Wörtern.
Ganz berühmte, frühe Beispiele dieser gomringerschen Wortkunst sind etwa „silencio“ (1954) mit der vielsagenden, zentralen Leerstelle und, von 1956, das wort- und sprachspielerische, „worte sind schatten / schatten werden worte“. Auf die Eröffnungsverse folgt die Feststellung „worte sind spiele / spiele werden worte“. Nach weiteren Variationen über das Thema steht am Ende die Conclusio: „sind worte spiele / werden schatten worte“. Dergleichen mag manch einem als Verbalklecks erscheinen, anderen aber, siehe beispielsweise Riha, Williams, Heißenbüttel, Kindler, als Literatur von Rang. Schließlich sind es, um diesen kleinen Exkurs (hoffentlich glücklich) zu Ende zu bringen, die wenigsten Lyrikerinnen und Dichter, die sich bereits zu Lebzeiten einer Gesamt-Werk-Ausgabe erfreuen können. Die im Falle Gomringers im Übrigen ganz wunderbar aufgemacht ist.
Auch ist es nicht so, dass Eugen Gomringer – obgleich die beiden seit nunmehr über sechs Dekaden ein einander innig vertrautes Paar sind – sich allein dem Konkreten verschrieben hätte. Zu seinem Achtundachtzigsten etwa hatte er just 88 seiner Frau Nortrud zugedachte Sonette beisammen. Erst jüngst hat der bekennende Novemberfan ein weiteres zu Papier gebracht, und auch dieses darf die promovierte Germanistin bald in Augenschein nehmen, obwohl sie den elften Monat (Gegensätze ziehen sich bekanntlich an) überhaupt nicht mag.
Wo wir gerade bei der Familie sind: Gomringer hat sieben Söhne undeine wohlbekannte Tochter. Seit April 2010 ist Nora Gomringer Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia Bamberg. Länger schon kennt man sie als prominente Vertreterin der Slam-Poetry-Szene, als eigenständige Lyrikerin auch. Anders als der Vater, auf den der zweite Bestandteil ihres kompletten Vornamens Nora-Eugenie verweist, hat die Tochter früh schon und seither immer wieder Preise bekommen.
Seit 2008 aber ist Gomringer père immerhin Träger des Bayerischen Verdienstordens, schon 1997 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Rehau zuteil (wo er seit 1976 zuhause ist und 2000 das IKKP Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie gegründet hat). 2009 wurde ihm der Rilke-Preis in der Kategorie deutschsprachige Dichtung zugesprochen, zwei Jahre hernach der Alice-Salomon-Poetikpreis Berlin.
Schon 1986 war Gomringer der erste Inhaber der Gastprofessur für Poetik an der Universität Bamberg, an der berühmten Düsseldorfer Kunstakademie lehrte er von 1978 bis 1990 Theorie der Ästhetik. Vorlesungen, Vorträge und Workshops hielt Gomringer auch in den Vereinigten Staaten, in Lateinamerika, in Portugal, in Großbritannien und – zu seinem Lebensthema („Von der Konkreten Kunst zur Konkreten Poesie“) – 2012 in der Kunstakademie Halle auf Burg Giebichenstein. Gemeinsam mit Nora wurde er im Sommer 2010 für eine Poetik-Dozentur an die Universität Koblenz-Landau eingeladen. Und dass die beiden immer wieder auch Lesungen à deux geben, versteht sich.
Demnächst, am 9. Dezember, werden sie bei einem „Dichter-Gespräch“ in der Berliner Akademie der Künste, deren Mitglied Eugen seit über vier Jahrzehnten ist, aufeinandertreffen. In Lesung und Wortwechsel sollen die Fragen verhandelt werden, was denn den Vater mit der Tochter verbindet, ob ihre Gedichte tatsächlich so unterschiedlich sind, wie sie zunächst erscheinen oder ob es nicht doch ein poetisches Verwandtschaftsband gibt. Wer den beiden zuhöre, so ist sich die Akademie in ihrer Ankündigung jedenfalls sicher, könne viel über die Konkrete Poesie und über die Sicht auf den anderen erfahren.
Zu Gomringer gehört, wie er sagt, die Umgebung. Man muss ihn erleben, in seiner Bibliothek, am Arbeitstisch, auf Ausstellungen, im Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie, das im Kunsthaus Rehau angesiedelt ist und in dessen Katalogsammlung sich rund 10 000 Schriften und Drucksachen finden. Konkret sei noch gesagt, dass zu den zahlreichen Stationen im langen Leben des Urvaters der Konkreten Poesie auch die Zeit als Kulturbeauftragter der Selber Rosenthal AG (von 1967 bis 1985) gehört und zuvor die als Geschäftsführer des Schweizerischen Werkbundes, von 1961 an.
Zahlreich sind naturgemäß die Kontakte zu Künstlern und Schriftstellern, die Freundschaften, die Gomringer – nicht nur seine Tochter ist bestens vernetzt – pflegt. Schon in jungen Jahren tauscht er sich mit Hermann Hesse aus, auch mit Othmar Schoeck, dem Zürcher Komponisten und Dirigenten, er begegnet selbstverständlich dem Architekten (und Autor) Max Frisch und – immer wieder an Bushaltestellen – dem Literaturnobelpreisträger von 1981, Elias Canetti.
Zur Musik sei noch gesagt, dass Gomringer 1958 in Ascona Mitarbeiter von Anthony van Hoboken am Werkverzeichnis von Josef Haydn war. Und dass es naturgemäß nicht nur – Gomringer sei es gedankt, aber auch Diter Rot, mit dem und Marcel Wyss zusammen er 1953 die Kunstzeitschrift „spirale“ gründet, sowie Dichtern wie Gerhard Rühm, Haroldo de Campos, Heinz Gappmayr, den Schotten Ian Hamilton Finlay und Edwin Morgan, dem Frankfurter Franz Mon und der Stuttgarter Gruppe um Max Bense und Reinhard Döhl – Konkrete Poesie gibt, sondern auch eine Musique concrète (Pierre Schaeffer, Edgar Varèse, ein wenig auch Pierre Boulez, Stockhausen, Mathias Spahlinger). Allerdings nicht von Haydn.
Ob man Gomringer zu seinem Neunzigsten ein Ständchen bringen wird? Vielleicht das Scherzo der „Symphonie pour un homme seul“ von 1950, eine Gemeinschaftskomposition von (Pierre) Schaeffer und (Pierre) Henry? Wir wissen es nicht. Gewiss aber ist, dass man ihm am 25. Januar im Kunstmuseum Bayreuth das Symposion „GO-90: konstruktiv-konkret“ widmen wird. Die Eidgenossen unterdessen lassen einen der wichtigsten ihrer Autoren aus der Nachkriegszeit einmal mehr links liegen.
Und das, obwohl im thurgauischen Dozwil bei der Edition Signathur ein Band mit biographischen Berichten sowie, 2008, „eines sommers sonette“ erschienen sind. Gomringer kann, und das ist auch gut so und sei ein zweites Mal gesagt, natürlich nicht nur konkret. Das zeigen auch die „wurlitzer verse“, die sich im vierten Band der Wiener Gesamtausgabe finden, und die man mit Vergnügen liest. Etwa diese:
das grün der weide mit der kuh
kein schöner bild für satte ruh.
indes die kuh hat ihre sorgen:
auf welcher weide es ich morgen?
Copyright Fotos:
Eugen und Nora Gomringer © Malte Göbel
Eugen Gomringer und sein bekanntestes Werk „Silencio“ © privat