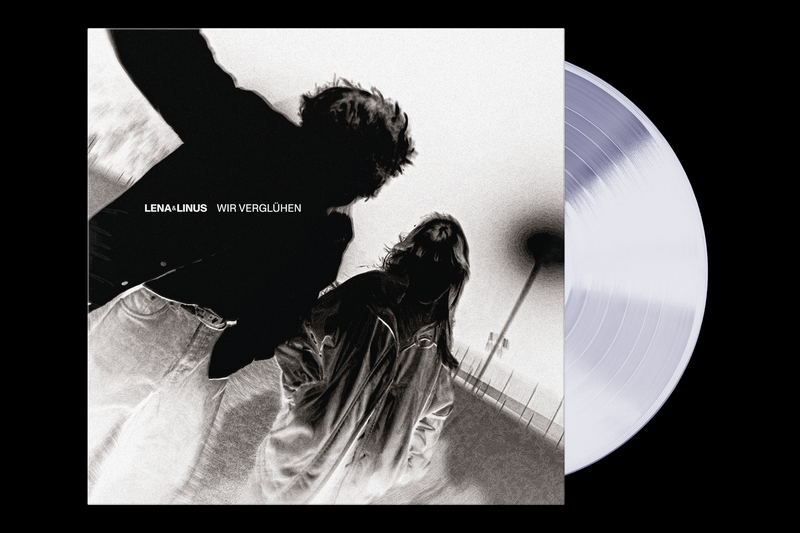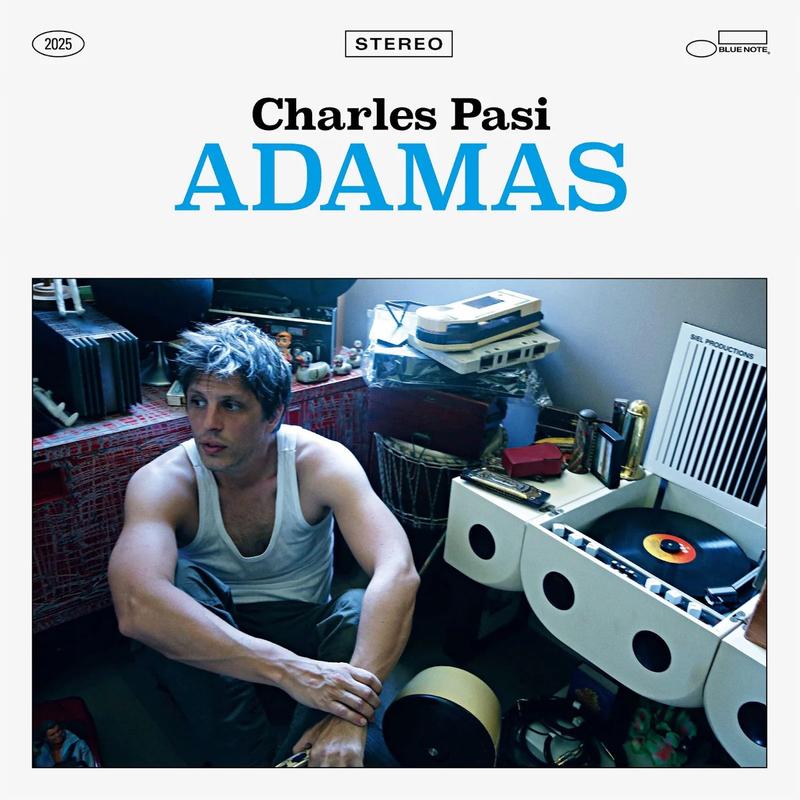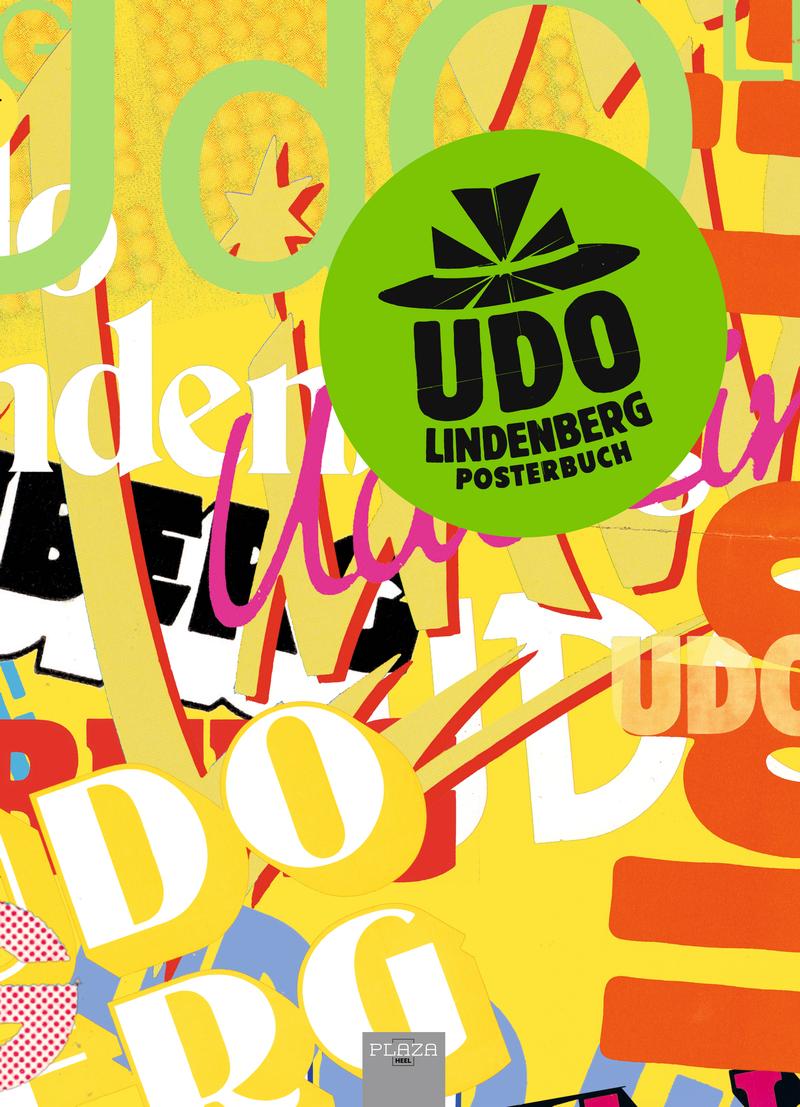Der Bamberger Dom in enzyklöpädischer Perspektive (Teil II)
Aus dem Alltag der Inventarmitarbeiter (Interview)
veröffentlicht am 22.06.2015 | Lesezeit: ca. 6 Min.
Wenn ein neuer Band in der Reihe „Die Kunstdenkmäler von Bayern“ erscheint, ist die Freude groß, doch die erwartungsfrohen Leser können kaum ermessen, welch mühsame Arbeit hinter einer solch aufwendigen Großpublikation steckt. Um ein paar Eindrücke aus dem Alltag des Projektteams zu gewinnen, unterhielten wir uns mit der langjährigen Mitarbeiterin Christine Kippes-Bösche.
Frau Kippes-Bösche, Sie sind seit vielen Jahren Mitarbeiterin beim ebenso renommierten wie ambitionierten Projekt der Inventarbände Bamberg des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Insbesondere haben Sie an den Bänden über die Immunitätsbezirke der Bergstadt mitgewirkt. Wie kommt man/frau dazu, welche Voraussetzungen werden erwartet?
CKB: Begonnen hat meine Mitarbeit beim Band über die Bürgerliche Bergstadt mit Zuarbeiten für Herrn Prof. Tilman Breuer: Auszügen aus den Baurechnungen der Oberen Pfarre.
Müsste man nicht die verschiedensten Fachrichtungen gut kennen oder gar studiert haben, um den Anforderungen dieses sehr vielfältigen und interdisziplinären Unternehmens gerecht zu werden?
CKB: Voraussetzung für die denkmalkundliche Forschung ist ein Fachstudium. Wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen habe ich Kunstgeschichte studiert und in Bamberg das Aufbaustudium Denkmalpflege absolviert. Hilfreich sind breit gefächerte Interessen und ein besonderer Draht zu den Dingen. Für die Bamberger Kunstschätze konnte mich ein befreundeter Heimatforscher schon während meiner Schulzeit begeistern.
Ist denn die Ehre, an diesem umfangreichen wissenschaftlichen Werk mitarbeiten zu dürfen, Entgelt genug, oder gibt es auch eine Honorierung im anderen Sinne des Wortes? Anders gefragt: kann man damit reich werden?
CKB: Nein. Die nicht im Landesamt für Denkmalpflege angestellten Mitarbeiter am Inventar der Kunstdenkmäler arbeiten auf Honorarbasis. Sie wissen ja aus eigener Erfahrung, dass gerade die öffentliche Hand für kulturelle Aufgaben nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat. Ein Kunsthistoriker, der reich werden will, hat wohl das falsche Studienfach gewählt.
Auf welche Bereiche bzw. Themen haben Sie sich spezialisiert?
CKB: Für den Band über den Kaulberg habe ich zunächst die Baugeschichte von Bürgerhäusern bearbeitet, dann für das Karmelitenkloster Baugeschichte und Ausstattung, ebenso später für St. Stephan und St. Getreu. Bei St. Jakob und St. Michael habe ich mich auf die Kirchenausstattungen spezialisiert.
Arbeiten Sie alleine oder im Team?
CKB: An jedem Band arbeitet ein Autorenteam, in dem jeder zwar sein eigenes Aufgabengebiet bearbeitet, aber auch den anderen zuarbeitet. Unverzichtbar ist die Hilfe der Mitarbeiter der Archive, Bibliotheken, Museen etc.
Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag an diesem Projekt aus, vor allem die Arbeit vor Ort?
CKB: Grundlage für die Forschung ist die Arbeit mit den Archivalien, die in Bamberg für viele Bereiche vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert nahezu lückenlos erhalten sind. Ein Tag im Staatsarchiv, im Diözesanarchiv oder im Stadtarchiv kann schnell mit dem auszugsweisen Abschreiben von Kirchenrechnungen vergehen. Für Baubegehungen müssen Termine mit den Hausbesitzern bzw. Kirchenpflegern vereinbart werden. Die Inventarisierung von Ausstattungsstücken mit Beschreibung, Maßen etc. kann bei größeren Beständen z. B. an Gemälden oder Möbeln sehr zeitaufwendig sein.
Auf welche Hindernisse und Gefahren stoßen Sie bei Ihrer Arbeit? Finden Sie stets problemlos Zugang zu eigentlich verschlossenen Gebäudebereichen, gibt es gefährliche Begehungen?
CKB: Abgesehen von der Gesundheitsgefährdung durch verschimmelte Handschriften, Berge von Taubenkot und toten Tieren auf Dachböden etc., gab es immer wieder potenziell gefährliche Begehungen in Dachstühlen, über Gewölben, in Kellern, auf Türmen und Gerüsten. In der Regel war ich da aber mit Kollegen unterwegs. Besonders dankbar bin ich dem Glockensachverständigen Herrn Claus Peter für die vielen gemeinsamen Begehungen der Glockenstuben. Schwindelerregend waren z. B. die Leitern zu den Glocken der Karmeliten und des Heilig-Grab-Klosters.
Mit welchen Themen haben Sie sich beim jetzt erschienenen Band über das Domstift, der im zweiten Teilband den Kapitelsbauten, der Ausstattung und dem Domschatz gewidmet ist, beschäftigt? Gab es da grundsätzlich neue Erkenntnisse zu präsentieren?
CKB: Für den Dom habe ich „normale“ Ausstattungsstücke, also nicht die Altäre, die berühmten Bildhauerwerke oder die gotischen Chorgestühle bearbeitet, sondern Orgel, Laiengestühl, Kanzel, Beichtstühle, Taufstein etc. Spannend fand ich hier die Detektivarbeit zur Rekonstruktion der abgegangenen und abgewanderten Ausstattung. Traurig ist z.B. das Schicksal des barocken Gestühls aus der in der Säkularisation abgebrochenen Franziskanerklosterkirche St. Anna, das an Dom, St. Jakob und St. Gangolf verteilt worden war. Nur in der Göttlichen-Hilf-Kapelle bei St. Gangolf stehen die Bänke noch. Aus dem Dom wurden sie nach Nürnberg an St. Elisabeth abgegeben, wo sie erst vor wenigen Jahren unerkannt im Zuge einer Neuausstattung zerstört wurden.
Begeistert hat mich die Bearbeitung des Kirchensilbers. Die Arbeit mit hochkarätigen Stücken aus dem Domschatz, wie der sogenannten Kunigundenlampe oder dem Hadriansschwert, hat mir wieder bewusst gemacht, dass der Bamberger Domschatz trotz aller Verluste nicht hinter den berühmtesten deutschen Kirchenschätzen zurücksteht.
Was steht jetzt für Sie an, werden Sie auch an der Erforschung der Theuerstadt und der östlichen Stadterweiterungen teilnehmen oder geht es gleich an die Erstellung der nächsten beiden Bände zum Domberg, die ja Hofhaltung, Residenz und Domherrenhöfe fokussieren?
CKB: Für den in Arbeit befindlichen Band 1 der Theuerstadt bin ich gerade dabei, die Texte zur Ausstattung der Otto-Kirche und des Heilig-Grab-Klosters, die wegen der Arbeit am Domband zurückgestellt waren, abzuschließen.
Ist ein Ende Ihrer Tätigkeit abzusehen?
CKB: Ich hoffe, dass ich bis zum letzten Band der Reihe der Kunstdenkmäler der Stadt Bamberg mitarbeiten kann.
Copyright Foto: © privat