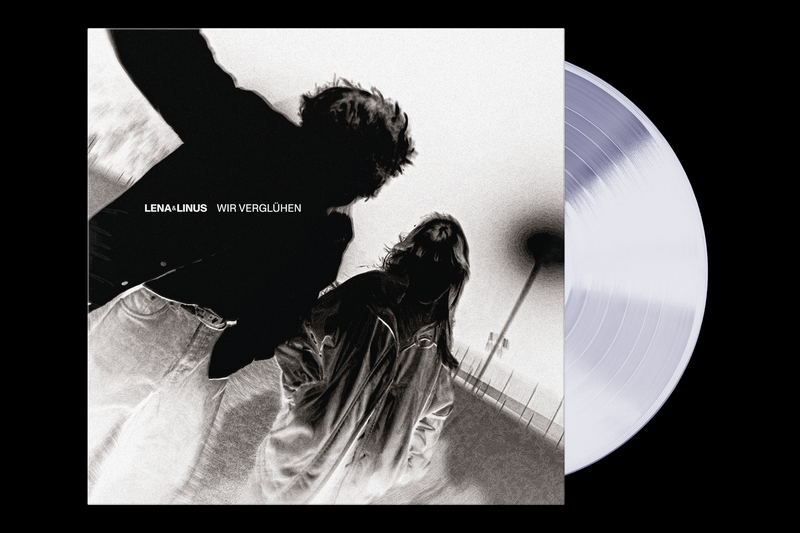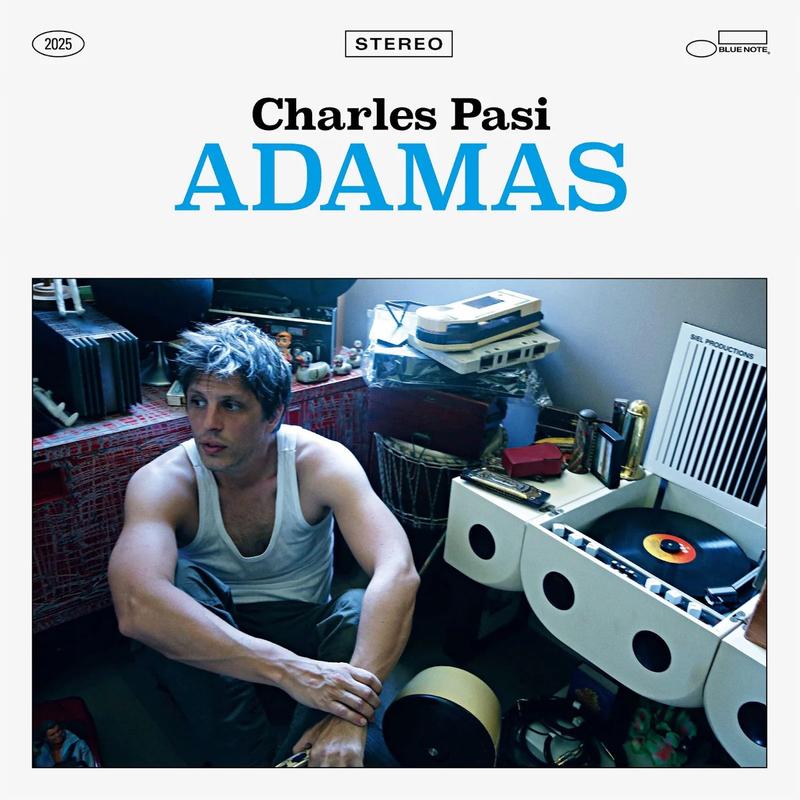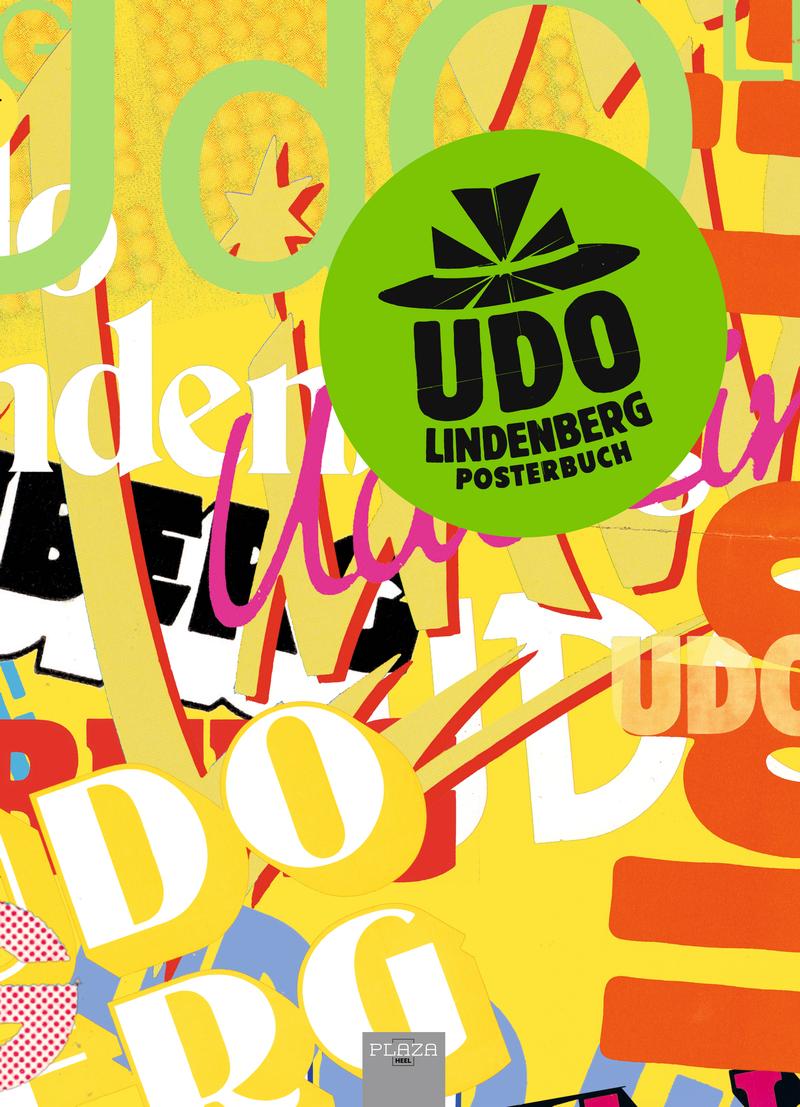Der Bamberger Dom in enzyklöpädischer Perspektive
Inventarband über das Domstift ist frisch erschienen
veröffentlicht am 22.06.2015 | Lesezeit: ca. 6 Min.
Es geht vorwärts! Seit 25 Jahren verfolgen wir nun schon das Mammutprojekt der Inventarbände zur Stadt Bamberg, haben sie fleißig gekauft und gewinnbringend gelesen, dem jeweils nächsten entgegen gefiebert und uns immer wieder von Neuem über die schiere Menge des dort ausgebreiteten Wissens gewundert. Im Mai wurde endlich der besonders ungeduldig erwartete Band über das Domstift der Öffentlichkeit vorgestellt – notabene im Dom – und ausgeliefert. In Wirklichkeit sind es zwei schwergewichtige Konvolute (von knapp sieben Kilo ist die Rede!), die jedoch ihrerseits nur Teilbände jenes bis 2020 vollständig erscheinenden Gesamtbandes 2 sind, der das gesamte Gebiet des vormaligen Castrum Babenberg behandelt, mithin den Domberg. Der im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege herausgegebene und vom Heinrichsverlag/Bayerische Verlagsanstalt Bamberg (in Kooperation mit dem Deutschen Kunstverlag Berlin/München) erstellte Band trägt den vollen Titel „Die Kunstdenkmäler von Bayern. Stadt Bamberg 2 – Domberg 1: Das Domstift. Teil 1: Baugeschichte, Baubeschreibung, Analyse. Teil 2: Ausstattung, Kapitelsbauten, Domschatz“ und entstand unter der inhaltlichen Gesamtverantwortung von Matthias Exner, Referatsleiter im Landesamt.
Generalkonservator Mathias Pfeil betonte anlässlich der Buchvorstellung die Sonderstellung Bambergs unter den bayerischen Städten hinsichtlich der Denkmalinventarisierung: es sei die einzige Stadt, der ein so umfangreiches wissenschaftliches Werk aus der Reihe „Die Kunstdenkmäler von Bayern“ gewidmet ist. Der Spiritus Rector dieses Generationen übergreifenden Unternehmens, Tilmann Breuer, der 1990 als intimer Bamberg-Kenner für den Start des Projektes sorgte und selbst mannigfaltige Beiträge lieferte, bekam ebenso wie der anwesende Erzbischof Ludwig Schick eines der ersten Exemplare überreicht.
Federführer Matthias Exner stellte in seiner inhaltlichen Einführung, auf die wir im Folgenden Bezug nehmen, die konzeptuellen Grundprinzipien der beiden Teilbände vor und deutete an, dass gerade auch bei den eigentlich schon sattsam erforschten oder zumindest kommentierten Kunstwerken ersten Ranges wie z.B. dem Bamberger Reiter, der Kaisertumba Tilman Riemenschneiders, dem Papstgrab Clemens II. oder dem Retabel des Veit Stoß mit neuen und zum Teil überraschenden Erkenntnissen aufgewartet werden kann.
Im Fokus der Publikation stehen der Dom, seine Vorgängerbauten sowie dessen engster Umgriff. Teilband 1 befasst sich mit der Baugeschichte und bietet eine Baubeschreibung der Kathedrale nebst einer Dokumentation der mittelalterlichen Bauplastik. Hinzu treten Befunde archäologischer Forschungen zum Heinrichsdom von 1012, die Darstellung bautechnischer Besonderheiten des Doms aus dem 13. Jahrhundert und eine Bewertung der langjährigen dendrochronologischen Untersuchungen an den Holzkonstruktionen. Im Übrigen erlaubt es die Auswertung der ab 1539 lückenlos erhaltenen Rechnungen über die Baumaßnahmen am Dom, bauliche Veränderungen und Restaurierungsarbeiten am Bauwerk exakt nachzuvollziehen.
Neue Erkenntnisse erbrachte die eingehende und methodisch konsequente Betrachtung der drei großen Figurenportale durch Dorothee Diemer. Zu den überraschendsten Entdeckungen gehört der Nachweis der Existenz einer hölzernen Wandverkleidung im eigentlich unzugänglichen ersten Obergeschoss des Nordwestturms, deren Funktion freilich noch nicht definitiv geklärt ist. Die Autoren des Kapitels „Bautechnische Beobachtungen“ halten ihn für einen Tresorraum, in dem „hochwertiges, vermutlich liturgisches Gerät“ gelagert wurde. Dafür spricht zweifelsohne die Feuchtigkeit regulierende Funktion der Wandverschalung, die der Kondensation an den kalten Steinflächen entgegenwirkte.
Die isometrischen Darstellungen Dethard von Winterfelds aus dem Jahre 1979 wurden in einer Weise verwertet (durch graphische Nachbearbeitung), welche die von Ost nach West fortschreitende Bauentwicklung auch für Laien leicht nachvollziehbar macht. Ergänzt wird diese Illustration durch die Erstellung fünf großformatiger Plantafeln im Maßstab 1:200, die auf dem digitalen Domprojekt von Universität Bamberg und Staatlichem Bauamt beruhen und den Bestand anschaulich wiedergeben.
Teilband 2 beinhaltet neben der gesamten Ausstattung des Domes auch den Domschatz und die Kreuzhof-umbauung. Besonderes Augenmerk wurde laut Matthias Exner auf die lange vernachlässigten, weil 1830 leider recht verlustreich freigelegten Malereien der Westchorschranken gelegt. Dem berühmten Veit-Stoß-Retabel aus der Nürnberger Karmeliterkirche durfte Christoph Bellot 30 Druckseiten des Teilbandes gönnen, auf denen er die komplexe Geschichte dieses Hauptwerkes des Künstlers ausbreitet und Überlegungen zu dessen ursprünglicher Gestalt anstellt. Stolz ist man bei den Mitarbeitern dieses Bandes auf die erste systematische Edition der beiden gotischen Chorgestühle, vor allem auf die Darstellung des formenreichen Gestühls im Westchor. Bezüglich Tilman Riemenschneiders Kaisergrabmal wird die Vermutung geäußert, dass dieses Unternehmen als ein Bamberger Prestigeobjekt in bewusster Konkurrenz zum spektakulären Sebaldusgrab der Vischer-Werkstatt in der Nürnberger Sebalduskirche verstanden werden kann.
Wer dieses opulente Werk in die Hand nimmt, wird kaum der Versuchung widerstehen können, recht bald nach jenen Seiten zu suchen, die sich mit dem Bamberger Reiter beschäftigen. Bekanntlich sind darüber ganze Bibliotheken geschrieben worden, doch Dorothea Diemer gelingt es auf relativ knappen 15 Seiten, das Kunstwerk zu beschreiben und die wichtigsten Deutungen zu diskutieren. So viel vorweg: die gängige Option, es sei König Stephan von Ungarn, wird verworfen. Ob man im Reiter – als Teil eines umfangreicheren, aber nicht vollendeten Bildprogramms für den Lettner – den jüngsten der Heiligen Drei Könige erkennen kann (wie schon 1902 geäußert), klingt einstweilen spekulativ, wird aber durch stichhaltige Argumente, die vor allem auf die französischen Vorbilder abheben, als ernsthafte Hypothese präsentiert. Es muss allerdings die Frage gestellt werden dürfen, ob für eine trotz aller Indizien relativ gewagt erscheinende Deutung ein Inventarband der richtige Platz ist. Eines ist sicher: die Debatten über diesen Vorstoß hinsichtlich des Reiters werden nicht lange auf sich warten lassen.