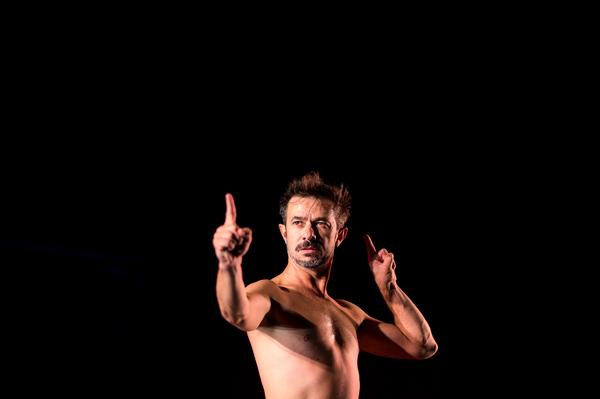Die Ära Bauhaus
100 Jahre Reformbewegung – Eine Stilschule erobert die Welt
veröffentlicht am 01.02.2019 | Lesezeit: ca. 18 Min.
Es ist so weit. 2019 ist noch frisch und alle Design- und Architekturbeflissenen dürfen sich schon jetzt freuen: Heuer begeht die (Re-)Formschule Bauhaus ihr hundertjähriges Bestehen und alle Welt feiert mit. Nachdem das Bauhausjahr im Januar in der Hauptstadt eröffnet wurde, ist der Startschuss für zahlreiche Veranstaltungen, nicht nur in den Bauhaus-Zentren Weimar, Dessau und Berlin, sondern überall in der Bundesrepublik gefallen. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kleine, von uns zusammengestellte Auswahl der wichtigsten Termine. Doch zunächst einmal wagen wir einen Blick in die Vergangenheit – und auch die Gegenwart. Was ist das Bauhaus, wofür steht es und was ist davon heute noch übrig?
Ein Besuch in Dessau – Ehrfurcht und späte Ernüchterung
Um diese Fragen beantworten zu können und uns auf ein Jahr im Zeichen der Kunst-, Design-, Architektur- und Gedankenschmiede einzustimmen, haben wir dem Bauhaus in Dessau bereits im Juni 2018 einen Besuch abgestattet. Biegt man in die Gropiusallee ein und parkt am Bauhausplatz, steht es plötzlich vor einem: ein Schiff aus Beton und Glas. Es thront auf der anderen Straßenseite, gibt sich aber aufgrund seiner gläsernen Vorhangfassade trotzdem zurückhaltend. Man hätte es überall vermutet, aber nicht inmitten eines ruhigen Wohngebiets. Während ein Vater gerade mit seiner Tochter nach Hause kommt und die Tür zum Häuserblock aufschließt, stellt sich dem Kunsthistoriker und Denkmalpfleger bei dieser Szenerie unweigerlich die Frage, wie es wohl ist, hier zu wohnen – mit dem täglichen Blick auf eines der legendärsten Bauwerke, die die Architekturgeschichte hervorgebracht hat; in dem Ikonen wie Gropius, Feininger, Schlemmer und Breuer aus- und eingingen, lehrten, studierten und ausufernde Partys feierten. Aber der Küchenfensterblick reicht uns nicht. Wir erspähen den Eingang mit den unprätentiösen, formschönen Lettern „Bauhaus“ darüber, die Walter Gropius übrigens frühzeitig namensrechtlich sichern ließ, halten kurz inne und gehen rein. Wie zu erwarten, macht sich beim Durchschreiten der Gänge Ehrfurcht breit. Noch heute wird in Bildungsprogrammen der Akademie der hauseigenen Stiftung in den berühmten Dessauer Hallen gelehrt und trotz der Stille, die an diesem Tag herrscht, kann man die Euphorie von damals noch immer spüren. Natürlich schauen wir uns auch die sogenannten Meisterhäuser wenige Straßen weiter an, die Gropius nach dem Baukastenprinzip als drei baugleiche Doppelhäuser und ein Direktorenhaus entworfen hat und in denen Bauhausmeister wie László Moholy-Nagy, Wassily Kandinsky oder Paul Klee mit ihren Familien lebten und arbeiteten. Im Haus „Oskar Schlemmer“ wohnen auch heute wieder Künstler mit ihren Familien, weswegen eine Besichtigung nicht möglich ist. Abgesehen von den neu errichteten, von außen ähnlich gestalteten Häusern „Moholy-Nagy“ und „Walter Gropius“, die auf dem Prinzip ineinander gestapelter Kuben basieren (besonders eindrucksvoll im Direktorenhaus zu erleben) und irgendwie fremdkörperhaft wirken, umweht uns auch hier das gleiche Gefühl von Aufbruch und Innovationsgeist wie in der Gropiusallee. Längst zurück von der Reise, weicht dieses Gefühl gegen Ende des Jahres jedoch jenem der Ernüchterung. Die Nachricht, dass das Bauhaus ein Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet absagt, weil Neonazis einen Protestmarsch angekündigt haben, schlägt ein wie eine Bombe. Medien, Politiker und Co. kritisieren diese Entscheidung aufs Schärfste, stellt sich doch sofort die Frage, ob hier nicht komplett entgegen des Bauhausgeistes gehandelt wurde.
Denn ein Blick in die Vergangenheit verrät, dass sich das Bauhaus seit Bestehen ständigen Angriffen von rechts erwehren und sich schließlich endgültig fügen musste, als es 1933 wegen unzumutbarer Auflagen seitens des Nationalsozialisten vom Meisterrat aufgelöst wurde. Obwohl Walter Gropius wie kaum ein anderer für die schöpferische Freiheit und avantgardistische Geisteshaltung am Bauhaus stand, ließ er den 1928 zum Leiter ernannten Hannes Meyer bereits zwei Jahre später wieder von der Stadt Dessau entlassen. Aus Angst vor den Nazis und einem jähen Ende des institutionellen Bauhauses, denn mit dem Amtsantritt Meyers wehte an der Akademie ein neuer, kommunistisch angehauchter Wind. Bloß keinen Ärger provozieren, der die Existenz und den Ruf der Institution gefährden könnte, schien die Devise zu lauten. In Anbetracht dessen lassen einem die Parallelen zu den Vorkommnissen der jüngsten Vergangenheit die Haare zu Berge stehen. Aber immerhin: So wurde eine Debatte angestoßen, die vielleicht längst überfällig war.
Wie alles begann – Ästhetik neu definiert
Die Debatte, die Walter Gropius 1928 scheute, lag zum einen sicher in seinen Kriegserfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg begründet, die dazu führten, dass er künftig jeglicher politischer Parteinahme abschwor, zum anderen darin, dass es für ihn selbst ein ungeheurer Kraftakt gewesen sein musste, das Bauhaus und seine Ideen auf Dauer zu etablieren – auch wenn ihm das Propagieren leichtfiel, denn er war ein begnadeter Redner und wurde für sein rhetorisches Talent ebenso bewundert wie gefürchtet. Feinde jedenfalls hatte Gropius von Anfang an.
Dabei waren seine Ideen keineswegs neu. Bereits 1907 formierten sich Architekten, Künstler, Handwerker und Unternehmer zu einer Allianz, die vor dem Hintergrund der Industrialisierung eine Versöhnung von Kapitalismus und Kultur anstrebten. Der Deutsche Werkbund, der noch heute wirkt, war geboren. Im Vordergrund sollte nicht mehr länger die bloße Gewinnmaximierung stehen, die dazu führte, dass die Qualität, vorerst vor allem kunstgewerblicher Produkte, zunehmend litt. Zur Sicherung der Qualität war dem Werkbund daran gelegen, einen neuen, vereinfachten Formenkanon zu entwickeln, der sich der Zweckmäßigkeit verschreibt. Dies sollte durch eine Reduktion der bis dato vorherrschenden, aufwändig herzustellenden, Ornamentik erreicht werden.
Auch Walter Gropius, seines Zeichens Architekt, wenn auch ohne Diplom, schloss sich 1910 der Werkbund-Bewegung an und beschäftigte sich zunehmend mit dem neuen Verständnis von Ästhetik. Die Nutzform zur Kunstform zu erheben, um stets dem „Zeitgeist“, wie er es formulierte, Tribut zu zollen, setzte er bereits 1911 bei der Realisierung seines ersten eigenen Auftrags – dem Bau des Fagus-Werks in Alfeld – um, das später als Inkunabel des „Neuen Bauens“ gefeiert werden sollte. Damit entwickelte er den Ansatz des Werkbundes noch einmal weiter, denn im Gegensatz dazu lehnte er jegliche historistische oder in alten Traditionen verhaftete Formgebung der Salonkunst gänzlich ab. Ihm ging es nicht mehr um die Ausbalancierung von künstlerischen, wirtschaftlichen und moralischen Forderungen, sondern um das radikale Überhöhen der Kunst, die sich die Technik zu Nutze machen sollte.
Lehre - Die Anfänge in Weimar und was danach kam
Da Gropius den Künstler als Genie begriff, sollte dieser nie hinter der Technisierung zurückstehen. Seine gestalterische Freiheit sollte stets gewahrt bleiben. Vom Studium der Architektur enttäuscht und nach Ende des Ersten Weltkrieges von der allgemeinen Aufbruchstimmung gepackt, wollte er die Lehre revolutionieren. Dazu strebte er eigentlich den Chefposten der 1904 in Weimar gegründeten und von Werkbund-Pionier Henry van de Velde entworfenen großherzoglichen Kunstgewerbsschule an. Die Schule wurde aber noch während des Krieges geschlossen und es Bestand nach Ende des Kaiserreiches auch kein Bedarf mehr, sie wiederzueröffnen. Übrig blieb allerdings die Hochschule für Bildende Künste, für die eine neue Stelle für Architektur geschaffen werden sollte. Gropius bewies hier erneut Innovations- und Kampfgeist, denn er forderte die Zusammenlegung beider Hochschulen unter dem Namen „Bauhaus“. Man mag es kaum glauben: Obwohl die Mühlen der Bürokratie bekanntlich langsam mahlen, gab man dem Antrag 1919 statt. Dem Nachkriegschaos sei Dank. Der Name „Bauhaus“ erklärt sich im Bauhausmanifest, in dem der neue Direktor dem Bauen die zentrale Rolle zuspricht. Architekten, Maler und Bildhauer sollten die Architektur wieder als eine Einheit begreifen, zusammenwirken und der Baukunst neuen Geist einhauchen.
„Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! Denn es gibt keine „Kunst von Beruf“. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. […] die Grundlage des Werkmäßigen aber ist unerläßlich für jeden Künstler. Dort ist der Urquell des schöpferischen Gestaltens. Bilden wir also eine neue Zukunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte!“ (Walter Gropius, 1919)
Mit diesen Worten erklärte Gropius die Entakademisierung zum obersten Ziel. Um dies auch zu erreichen, erforderte es mehrere Maßnahmen. Eine der ersten war die Einführung des ein- bzw. zweisemestrigen Vorkurses, der zunächst von Johannes Itten und nach dessen Ausscheiden aus dem Bauhaus 1923 wegen Differenzen zwischen ihm und Gropius von László Moholy-Nagy und Josef Albers durchgeführt wurde. Hier ging es darum, Grundlagen in der Materialkunde, Werk- sowie Formlehre zu erwerben, um dann zu einer der Werkstätten – der zweite, sechs Semester umfassende Pfeiler der neuen Lehrmethodik – zugelassen zu werden. Obligatorisch war der Vorkurs ab 1930 nicht mehr und entwickelte sich mehr und mehr zu einem Freihandzeichenkurs. Die Auslese der Studenten übernahmen nun separate Prüfungen am Ende jedes Semesters.
Wichtiger noch als der Vorkurs waren die Werkstätten, von denen es in Weimar zehn, später dreizehn an der Zahl gab – vornehmlich kunstgewerbliche. In Dessau wurden sie unter der Leitung Hannes Meyers auf sieben minimiert bzw. zusammengefasst. Eigentlich sollte nach Abschluss einer Werkstatt eine Architekturausbildung folgen. Diese Strukturierung wurde allerdings ausschließlich in Gropius‘ letztem Amtsjahr von 1927-28 erprobt, weshalb die Architektur für viele Abgänger wenig Relevanz hatte. Als Schüler legte man zunächst die Gesellenprüfung ab (und war damit Jungmeister) oder schloss eine Meisterausbildung an. Ab 1926 wurde es außerdem möglich, ein Bauhaus-Diplom zu erwerben. Dieses jedoch befähigte nicht zur Promotion oder zum Eintritt in den Staatsdienst als Regierungsbaumeister. Erst mit dem Amtsantritt Ludwig Mies van der Rohes 1930 in Dessau (von 1932-33 als Privatschule in Berlin-Lankwitz weitergeführt) kam der Architektur am Bauhaus mit der Einführung eines Architekturstudiums ein höherer, um nicht zu sagen der größte Stellenwert zu. Der neue Direktor schaffte die Formlehre und die Vorkurse gänzlich ab. So entfernte er sich immer mehr von der ursprünglichen Idee Gropius‘ von einer antiakademischen, „unverschulten“ Lehranstalt, was aber in Teilen sicher auch den erschwerten Bedingungen unter der Herrschaft der National-
sozialisten zuschulden war.
Natürlich gehörte zum Leben am Bauhaus – wenigstens zu Weimarer und Dessauer Zeiten – auch das ausgelassene Feiern, zu Gunsten einer ganzheitlichen Bildung und im Sinne der freiheitlichen Lehre. Man mag darüber schmunzeln, aber das Bauhaus wäre heute nicht annähernd so legendär, hätten sich die Meister und Lehrlinge nicht als Avantgardisten verstanden. Es war gewollt, dass Schule und Privatleben in engem Zusammenhang standen, dass man sich zu Happenings traf, Maskenbälle feierte oder sich auf dem Dach des Ateliergebäudes zur Gymnastikstunde traf. All das machte den Geist des Bauhauses aus und trug zu seiner Mystifizierung bei.
Grund für die Umzüge nach Dessau (1925) und Berlin (1932) waren beide Male Restriktionen der immer stärker werdenden rechten Kräfte. Die Landtagswahlen in Thüringen 1924 führten dazu, dass dem Bauhaus die Hälfte des Etats gestrichen wurde. Als einzigen Ausweg sah man den Umzug in eine andere Stadt. Dessau bot sich an, auch weil der Flugzeugbauer Hugo Junker als Förderer auf der Bildfläche erschien. Mit dem Bau des Dessauer Schulgebäudes konnte Walter Gropius sein nächstes Projekt des „Neuen Bauens“ verwirklichen. Um das Gebäude in Gänze zu begreifen, lohnt sich die Vogelperspektive oder eine Umrundung des Geländes, denn ständig eröffnen sich neue Sichtweisen. Das ist so gewollt, denn die Gestaltung folgt Gropius‘ eigenem Verständnis von Leichtigkeit und rhythmischer Dynamik. Zudem ließ Gropius Versatzstücke der niederländischen „De Stijl“-Bewegung unter Theo van Doesburg einfließen, die die „mechanische Ästhetik“, also eine Form des Konstruktivismus, propagierte und ausschließlich Ausdrucksmittel wie die Grundfarben Rot, Blau, Gelb und die Nichtfarben Schwarz, Weiß und Grau als flächige, rechtwinklige Formen sowie Vertikalität und Horizontalität erlaubte. Getreu dem alten Chicagoer Leitsatz „form follows function“ war es ihm außerdem daran gelegen, dass die innere Raumfunktion auch von außen ablesbar ist.
Schon in Weimar absehbar, entwickelte sich das Dessauer Bauhaus nun immer mehr in Richtung industrielles Bauen. Zu den Projekten, die im Zuge der neuen Ausrichtung realisiert werden konnten, zählt auch die Siedlung Dessau-Törten, die in puncto Komfort und Praktikabilität jedoch noch ausbaufähig war und „Kinderkrankheiten“ wie eine undurchdachte Lichtsituation aufwies. Besser umgesetzt werden konnte das sogenannte „Neue Wohnen“ dagegen im Musterhaus „am Horn“, das noch nach dem Prinzip der Wabenbauweise konzipiert war, und in den Meisterhäusern. Hier konnte das Bauhaus den eigenen Ansprüchen von einem vereinfachten Leben im Sinne des Menschen gerecht werden, indem die Grundrisse den Arbeits- und Lebensabläufen unterworfen und möglichst praktikabel gestaltet wurden. Mehr noch als in der Architektur schlug sich diese neue Denkweise in den Bauhausmöbeln nieder. Schlicht und leicht sollten sie sein und schnell auf- und auseinanderzubauen gehen. Man entdeckte das Stahlrohr als perfektes Gestaltungselement für sich – Marcel Breuers Armlehnenstühle B 64, in Kombination mit Rohrgeflecht, und B 35, mit Stoff bespannt, sind noch heute beliebte Designklassiker. Heute zwar fast unbezahlbar, gab es unter dem Bauhausleiter Hannes Meyer zumindest zwischenzeitlich Bemühungen, diese Möbel als Standartprodukte auf dem Markt zu etablieren und sie für jedermann erschwinglich zu machen.
Über alle Grenzen – Das Bauhaus erobert die Welt
Nachdem das Bauhaus geschlossen werden musste, suchten sich die Bauhäusler – oft im Exil lebend – neue Aufgaben. Besonders in den USA war man offen für die Lehren und Ideen des Bauhauses. Unter den Exilanten: Josef Albers, Walter Gropius, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer und Ludwig Mies van der Rohe. Besonders eng an das „alte“ Bauhaus angelehnt war das 1937 gegründete „Institute of Design“ in Chicago, an das Moholy-Nagy als Direktor berufen wurde. Walter Gropius folgte einem Ruf als Professor an die Harvard University und steht heute wie kein Zweiter für den Ruhm und Mythos des Bauhauses. Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Weiße Stadt in Tel Aviv, in der jüdische Bauhaus-Architekten über 4.000 Häuser im Bauhaus-Stil errichteten – sofern man das Bauhaus als Stil und nicht als Schule oder eine fortlaufenden Entwicklung der Frage, wie sich Leben, Bauen und Wirtschaftlichkeit möglichst adäquat vereinen lassen, verstehen will – und die ebenso wie die deutschen Bauhausstätten zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben wurde.
Auch in Deutschland gab es Bestrebungen, das Bauhaus neu aufleben zu lassen. Bauhaus-Absolvent Max Bill eröffnete 1953 in Ulm die Hochschule für Gestaltung, mit allem, was das Bauhaus ursprünglich auszeichnete. Doch auch dieses „Projekt“ war 14 Jahre später zum Scheitern verurteilt. Und wieder war es die Politik, die mit Aufkommen der 68er-Bewegung kurzerhand die Mittel strich.
Und heute?
Das Bauhaus in Dessau existiert heute nur noch als Museum und in diesem Rahmen auch als Ort für internationale Workshops. Die DDR tat sich mit dem Vermächtnis der heute so berühmten Ideenstätte lange Zeit schwer, verharrte ewig in der Formalismus-Debatte, die dem Bauhaus imperialistische Dekadenz vorwarf. So stand man sich selbst im Weg, denn hätte man genauer hingesehen und wäre nicht im eigenen Dogma erstarrt, wäre aufgefallen, dass das Bauhaus den Funktionalismus nie begraben hat. Moskau hatte allerdings auch ein Wörtchen mitzureden und so kam es, dass man sich dem eigenen Erbe erst 1976 zuwandte, das Bauhausgebäude denkmalgerecht rekonstruierte und das Wissenschaftlich-Kulturelle Zentrum (WKZ) gründete. Das WKZ initiierte den Aufbau der heutigen Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau und reaktivierte die Bauhausbühne. Kurz nach der Wende, 1994, wurde schließlich die Stiftung Bauhaus Dessau gegründet, die die Aufgaben des WKZ fortführte und bis heute dem künstlerisch-wissenschaftlichen Auftrag verpflichtet ist, die Sammlung zu erhalten, erforschen und vermitteln.
Im ehemaligen Bauhaus-Gebäude in Weimar befindet sich heute die Bauhaus-Universität, die in der Lehre aber längst nicht mehr der Bauhaus-Tradition verhaftet ist. Anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums hat die Uni Weimar jedoch das Bauhaus.Semester initiiert, das sich in Vorträgen, Ausstellungen, Tagungen und Seminaren intensiv mit dem Bauhaus auseinandersetzt und sich mit (immer noch) aktuellen Fragestellungen wie der Freiheit von Wissenschaft und Kunst beschäftigt.
Die Lehren des Bauhauses wirken bis heute nach. Allein in Deutschland finden sich überall Hinweise aufs Bauhaus. Zahlreiche Architekten knüpften an das Bauhaus an – wo man hinsieht, laden Städte, Gemeinden und Stiftungen aktuell zum Entdecken des Bauhauses in all seinen Facetten ein.
Darüber hinaus werden im Bauhausjahr gleich zwei neue Museen in den Hauptwirkungsstädten Weimar und Dessau eröffnet. Nach dreijähriger Bauzeit wird am 6. April das Bauhaus-Museum eingeweiht. In direkter Nachbarschaft zum ehemaligen „Gauforum“ aus nationalsozialistischer Zeit, und dem „Langen Jakob“, ein Studentenwohnheim aus den 1970er-Jahren, macht es sich das neue Museum zur ehrgeizigen Aufgabe, diese Zeitschichten im Sinne des aktiven Diskurses miteinander zu verknüpfen. Man darf gespannt sein. Am 8. September dann eröffnet in Dessau der neue Bauhaus-Museumskomplex seine Pforten und präsentiert erstmals umfassend die Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau. Auch hier wird es spannend sein, zu sehen, was der Neubau künftig an Mehrwert zu bieten hat. Und auch in Berlin wird aktuell gebaut, hier erfährt das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung eine denkmalgerechte Instandsetzung und wird durch einen Museumsneubau voraussichtlich bis 2022 erweitert. Bis dahin ist also noch etwas Zeit und Geduld erforderlich, die zu überbrücken aber angesichts der zahlreichen Termine und Veranstaltungen sämtlicher Bauhaus-Pilgerstätten in Deutschland, zusammengefasst unter www.bauhaus100.de, keineswegs schwerfallen sollte.
Fotocredits:
Treppenhaus im Bauhaus-Gebäude Dessau, Foto © 2mcon, Franziska Krause-Gurk
Dessauer Bauhausköpfe (Bauhaus-Fotoalbum, Fritz Schreiber), © Stiftung Bauhaus Dessau
Bauhaus-Gebäude Dessau, Walter Gropius, 1925-1926, Foto © 2mcon, Franzsika Krause-Gurk
Zwei der Meisterhäuser in Dessau (Doppelhaus), Walter Gropius, 1925-1926, Foto © 2mcon, Franziska Krause-Gurk
Einbauschrank im Meisterhaus „Georg Muche“ in Anlehnung an De Stijl, Dessau, Foto © 2mcon, Franziska Krause-Gurk
Alfred Schäfter (Entwurf und Herstellung), Pendelleuchte, Prototyp, 1931/1932, © Stiftung Bauhaus Dessau, Foto: Gunter Binsack, 2018
Armlehnenstühle B 35 (mit Stoff bespannt), Marcel Breuer, 1928/29, Bauhaus Dessau, Foto © 2mcon, Franziska Krause-Gurk