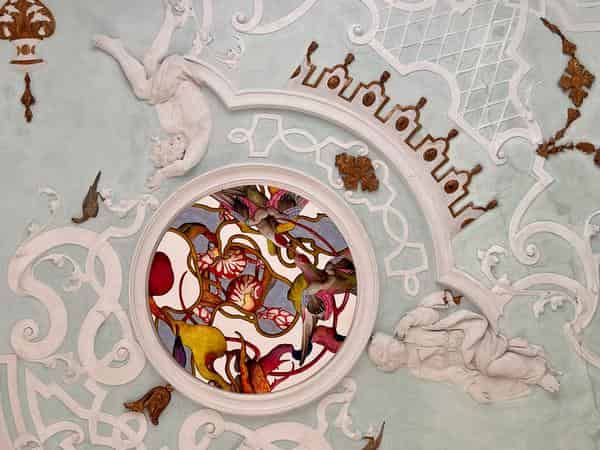Konzertmeister Peter Rosenberg sagt mit Mozart adieu
Drei Dekaden Moderator zwischen Dirigent und Orchestertutti bei den Bamberger Symphonikern
veröffentlicht am 09.10.2015 | Lesezeit: ca. 11 Min.
Peter Rosenberg, langjähriger Erster Konzertmeister der Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie, geht zu Beginn der kommenden Saison in den Ruhestand.
Der im rumänischen Klausenburg geborene Geiger studierte zunächst an der Rubin-Musikakademie in Tel Aviv bei Alice Fenyves, dann an der Musikakademie Detmold bei Tibor Varga und beendete sein Studium bei Saschko Gawriloff an der Folkwang Hochschule in Essen mit dem Konzertexamen. Er war Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, konzertierte international, machte Rundfunkaufnahmen bei deutschen Sendern und war zeitweise auch als Professor für Violine und Kammermusik pädagogisch tätig.
Herr Rosenberg, seit 32 Jahren sind Sie erster Konzertmeister der Bamberger Symphoniker, am 29. Oktober geben Sie Ihren Abschied vom Orchester mit einem Soloauftritt in Mozarts Violinkonzert A-Dur. Kommt da bei Ihnen Wehmut auf oder sagen Sie sich einfach „basta, irgendwann muss ja schließlich Schluss sein“?
Peter Rosenberg: Also „Basta“ passt nun wirklich nicht, denn das klingt so, als hätte man mit einer Sache definitiv abgeschlossen oder sei ihr sogar überdrüssig. Davon kann natürlich keine Rede sein, wenn man das Glück hatte, einen solch faszinierenden Beruf ausüben zu dürfen. Ich finde es allerdings okay, jetzt aufzuhören, weil ich nicht weiß, ob bei diesem anspruchsvollen und fordernden Job die Leistung noch beispielsweise für weitere zwei oder drei Jahre reicht. Schließlich muss man sich ständig selbstkritisch beobachten und sich fragen, ob nicht das eine oder andere Leistungsmerkmal nachlässt, ob beispielsweise die Technik noch tadellos ist. Bedenken Sie, dass unter den Instrumentengruppen eines Symphonieorchesters die hohen Streicher wegen der enormen feinmotorischen Anforderungen am frühesten „altern“, also im physiologischen Sinne nachlassen. Wir können nicht so lange durchhalten wie Pianisten oder gar Dirigenten. Übrigens gehen Konzertmeister häufig schon deutlich vor der Grenze von 60 Jahren in den Ruhestand beziehungsweise wechseln auf eine Professorenstelle, wo sie ihre enorme Erfahrung noch gewinnbringend nutzen können.
Die große Leere wird wohl kaum im Ruhestand auf Sie warten. Wie werden Sie sich musikalisch orientieren, welche Ziele oder unerfüllten Wünsche gibt es noch?
Peter Rosenberg: Zwei Dinge möchte ich nennen, die mir wichtige Anliegen sind. Einerseits reizt es mich geigerisch, mir die Violinsonaten Beethovens nochmals gemäß des heutigen Wissens- und Interpretationsstandes vorzunehmen, vielleicht auch die Solopartiten Bachs. Man kommt ja nie ans Ende mit diesen Ausnahmewerken. Andererseits möchte ich auch meiner rumänischen Heimat noch ein wenig zurückgeben. Deshalb fahre ich jetzt öfters nach Klausenburg (Cluj) und bin Mitinitiator einer Stiftung für die musikalische Förderung junger Leute. Hilfen für die Einbeziehung in kammermusikalisches Wirken, in die Erschließung der wunderbaren Volksmusik Rumäniens oder in die Jugendorchesterarbeit halte ich für notwendig und segensreich. Überhaupt, die Entwicklung der Jugendsymphonieorchester in ganz Europa ist eine der schönsten und fruchtbringendsten Ideen des letzten Jahrzehnts. Das bringt den Nachwuchs in jeder Beziehung voran, vor allem dient es auch der Horizonterweiterung in einer zunehmend sich globalisierenden Welt. An einem meiner Söhne, der im Bundesjugendorchester spielt, kann ich das sozusagen aus der Nähe verfolgen.
Wenn man nach dem Studium und ersten Preisträgerschaften zur Elite einer Instrumentengattung gehört, tun sich ja verschiedene Optionen auf. Bei den Geigern kann man neben der Konzertmeisterfunktion auch eine Solokarriere oder eine Professur anstreben beziehungsweise zum Primarius eines Streichquartetts avancieren. Musste es für Sie die herausgehobene Orchesterstelle sein?
Peter Rosenberg: Es musste natürlich nicht, aber es durfte gerne so sein. Wissen Sie, im Grunde genommen ist es das Ziel beziehungsweise der Traum jedes Musikers, möglichst frei musizieren zu können, in welcher Konstellation auch immer. Das will beileibe nicht heißen, nur eine Solokariere würde dies erlauben. Jede Einbindung in einen Brotberuf ist dann allerdings mit Einschränkungen beziehungsweise mit Kompromissen verbunden. Man muss sich deshalb die Frage stellen, was man mitzumachen bereit ist. Davon kann ich ein Liedchen singen, denn angesichts meiner Herkunft aus dem Rumänien der Ceau?escu-Zeit war ich ja diversen Zwängen ausgesetzt, und zwar nicht nur politischen. In der Musikerziehung beziehungsweise -ausbildung wie im Orchesterwesen herrschten erheblich rigidere Verhältnisse als hier in Deutschland. Da ging es allzu schnell um die Frage des Scheiterns in einem strengen Auslesesystem, nicht um die Möglichkeit, sich entfalten zu können. Insofern war für mich, bei aller gebliebenen Verbundenheit zu meinem Heimatland, der Wechsel in die ganz andersartige Musikkultur Deutschlands entscheidend.
Wie wird man eigentlich Konzertmeister, welche Hürden gilt es dabei zu überwinden?
Peter Rosenberg: Rein formal ist das Prozedere recht einfach, aber man sollte sich recht genau überlegen, welche Stellenausschreibungen in der Orchesterlandschaft in Frage kommen. Die richtige Selbsteinschätzung bezüglich der angestrebten Orchesterkategorie (es gibt mehrere Niveaustufen) ist dabei ebenso wichtig wie beispielsweise die Frage, ob es eher ein Opern- oder ein Konzertorchester sein soll. Ist es dann so weit, trifft die Instrumentengruppe eine Vorauswahl für die Einladung zum Probespiel, wobei die Kriterien Alter, Abschlüsse (eventuell auch Preise) und Berufserfahrung eine große Rolle spielen. Bei einem Konzertmeisteranwärter sind die Anforderungen an den Konsens im Orchester noch größer als bei der Besetzung anderer Stellen, weshalb bei der ultimativen Abstimmung grundsätzlich alle Orchestermitglieder beteiligt werden. Damit ist man aber noch nicht durch, denn es folgt das obligatorische Probejahr, in dem man sich bewähren muss hinsichtlich der zu absolvierenden Solokonzerte und -passagen, hinsichtlich der moderativen Geschicklichkeit im Verhältnis Dirigent/Orchester und nicht zuletzt auch bezüglich des menschlichen Umgangs mit der Kollegenschaft. Erst wenn das alles passt, hat man eine Chance, zum Konzertmeister eines großen Symphonieorchesters zu avancieren. Und dann gilt es, seine Absichten beziehungsweise Überzeugungen nach hinten und nach vorne zu kommunizieren, will heißen: zum Tutti hin und gegenüber dem Dirigenten.
Zerrt dieser Job sehr an den Nerven? Schließlich haben Sie ja kaum ein Recht auf Irrtum…
Peter Rosenberg: Natürlich können die langen Jahre des Exponiertseins doch sehr an einem nagen, manche zermürbt es sogar. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass die nervlich anspannende Situation für Konzertmeister durch eine relativ komfortable Dienstregelung gemildert wird, die einem ausreichend Rekreationszeiten ermöglicht. Bedenklich wird es spätestens dann, wenn man eigene Schwächen wahrzunehmen oder auch nur zu ahnen glaubt. Ein merkliches Nachlassen ist in diesem Job nämlich kaum tolerierbar, das hält man psychisch nicht aus. Stets sollte man zwischen 95% und 99% seiner Möglichkeiten abrufen können. Überzeugen die Soli nicht mehr oder zeigt man gar Unsicherheiten bei Einsätzen, dann wird es kritisch.
Kennen Sie Nervosität, zum Beispiel wenn Sie bei Bachs Solopartiten ganz allein auf dem Podium stehen oder wichtige Solopassagen in großen symphonischen Werken darstellen müssen?
Peter Rosenberg: Diese Frage knüpft natürlich an die vorhergehende an. Bei Soloaufgaben jedweder Art stellen sich ganz andere Probleme als bei der Stimm- oder Orchesterführung. Ich erwähne nur eines: Die Anforderungen des Auswendigspiels, für den reinen Solisten eine Selbstverständlichkeit, werden dem Tuttispieler genauso wie dem Konzertmeister allmählich fremd oder zumindest ungewohnt, weil das einfach zu selten vorkommt.
Sie haben praktisch Ihr halbes Leben als Konzertmeister der Bamberger Symphoniker verbracht und darüber hinaus auch oft in anderen Eliteorchestern ausgeholfen. Gibt es in der schieren Masse der damit verbundenen Auftritte solche, die Ihnen unvergesslich sind oder auf die Sie besonders stolz sind?
Peter Rosenberg: O je, da könnte ich viele nennen, aber spontan fällt mir einer unserer ersten Auftritte in den USA ein, als wir unter Eugen Jochum eine Brucknersymphonie in der Carnegie Hall interpretierten. Grandios! Ich bin zeitlebens glücklich darüber, diesen bedeutenden Dirigenten noch „erwischt“ zu haben.
Keine Tops ohne Flops – wann haben Sie sich einmal so richtig über sich selbst geärgert beziehungsweise wann ist Ihnen einmal etwas deutlich „daneben“ gegangen?
Peter Rosenberg: Man kommt nicht krisenfrei durch solch einen Job. Ob aber für das Publikum oder einen selbst etwas „daneben“ gegangen ist, macht einen großen Unterschied. Oft ärgert man sich über eine Unzulänglichkeit, die nur einem selbst oder allenfalls anderen Orchestermitgliedern aufgefallen, aber dem Publikum völlig entgangen ist.
Welches sind Ihre Favoriten unter den Geigerkolleg(inn)en in Vergangenheit und Gegenwart?
Peter Rosenberg: Wenn ich da mit einer Aufzählung beginne, könnte die Liste lang werden. Zur Gegenwart äußere ich mich keinesfalls, bezüglich der Vergangenheit wäre es ungerecht, Titanen wie Joseph Joachim, Fritz Kreisler, David Oistrach, Nathan Milstein oder Henryk Szeryng zu nennen und zugleich so viele andere Große unerwähnt zu lassen. In gewisser Weise zwischen Vergangenheit und Gegenwart steht jedoch Gidon Kremer, der, obwohl noch aus der alten russischen Schule kommend, das Geigenspiel um ungeahnte Facetten bereichert hat. Er hat den Fundamentalismus der puren Tonschönheit relativiert, neue Erkenntnisse hinsichtlich Artikulation und stilistischer Möglichkeiten umgesetzt und dergestalt zu einem umfassend überzeugenden Violinspiel gefunden. Bei ihm verbinden sich Kenntnisreichtum und Musikalität auf faszinierende Weise, von seiner technischen Brillanz ganz abgesehen.
Welche Dirigenten haben Sie besonders geschätzt?
Peter Rosenberg: Den schon erwähnten Eugen Jochum muss ich zuerst nennen, dann Horst Stein, Giuseppe Sinopoli, Herbert Blomstedt und neuerdings auch Daniele Gatti. Jonathan Nott nimmt natürlich eine Sonderstellung ein. Wir haben viel von ihm gelernt, auch er hat sich mit uns profilieren können. Das Orchester steht heute ganz anders da als vor seiner Zeit; denken Sie nur an den Mahler-Zyklus, der uns viel Renommée eingebracht hat.
Haben Sie die Interpretation zeitgenössischer Werke als Bereicherung empfunden oder bisweilen auch als Zumutung?
Peter Rosenberg: Ausnahmslos als Bereicherung, da kann ich mich ganz kurz fassen.
Stünden Sie abermals vor derselben Karriereentscheidung, würden Sie dann den Job nochmals machen? Und fänden Sie es wünschenswert, dass eines Ihrer Kinder in Ihre Fußstapfen tritt?
Peter Rosenberg: Vor einem solchen Traumberuf wird man kaum warnen wollen. Aber einer selbstkritischen Prüfung sollte man sich mit gewisser Strenge unterziehen und sich genau überlegen, ob man fähig und bereit ist, neben dem instrumentalen Können auch die Rolle eines Moderators zwischen Tutti und Dirigent überzeugend auszufüllen.

Marie Pellissier, Foto © Bilderhaus Gabi Mirgeler