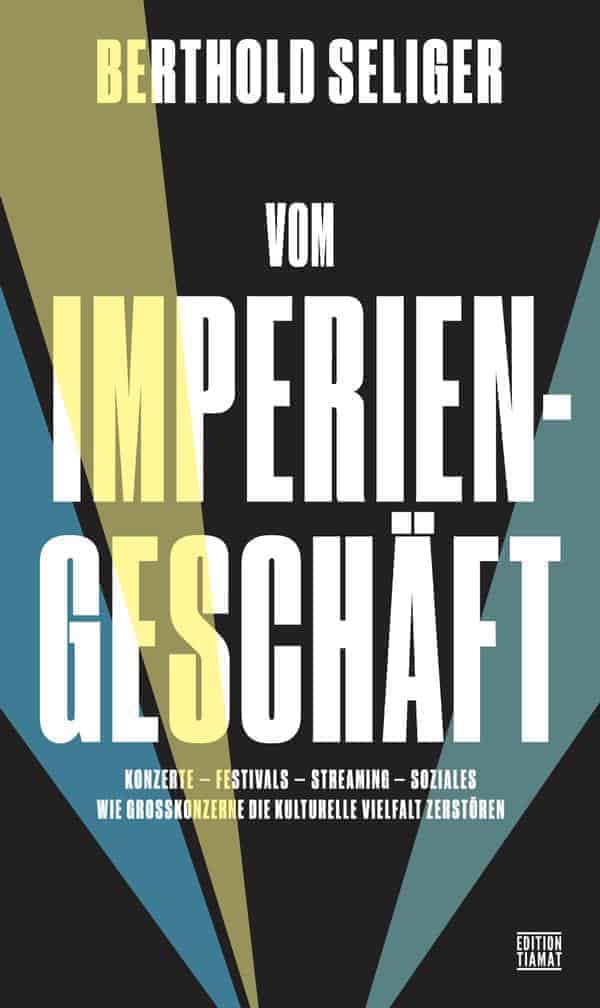Kultur DIGITAL II - eine Bestandssuche
Langzeitpioniere und Kurzzeitgedächtnis
veröffentlicht am 29.07.2019 | Lesezeit: ca. 5 Min. | von Oliver Will
Auf den theoretischen Annäherungsversuch an die Schnittstelle Kultur und Digital in der letzten Ausgabe folgt diesmal eine Stichprobenerhebung der Praxisfelder digitaler Kultur. Die digitale Welt, sonst grenzenlose Quelle für Impulse und Diskurse zu selbst den schwerfälligsten Themen, enttäuscht beim ersten Blick auf relevante Anknüpfungspunkte an und thematische Auseinandersetzung mit Kultur digital. Eine Befragung der Suchmaschinen bezeugt vor allem die Weite des Feldes. Und dies nicht nur inhaltlich gesprochen, sondern vor allem aus der zeitlichen Perspektive.
Der vielleicht größte Spieler dieses Genres, die Ars Electronica Linz, feiert 2019 ihr immerhin 40-jähriges Bestehen. Seit nunmehr vier Dekaden ist sie bereits Labor für die digitale Revolution, blickt auf aktuelle Entwicklungen und mögliche Zukunftsszenarien und fungiert dabei als weltweit einmalige Plattform für Kunst, Technologie und Gesellschaft. Scheinbar hat sie die Dimension und Transformationsrelevanz der Digitalisierung mit weiter Voraussicht erfasst und mit beständigem Pioniergeist entwickelt. Der Digital-Artist von Welt trifft sich in Linz, um Bildungsperspektiven, Futurelabs, Kunstfestivals, CyberArt, Ausstellungen, Events und Anwendungen zu gestalten. Kunst und Technik sind neu vereint und tragen zur Veränderung der Gesellschaft bei, in alten und neuen Allianzen. So die zentrale Botschaft und logische Schlußfolgerung eines sich digitalisierenden Kunstbetriebs. Die gesamte Kunstwelt befindet sich im Bauhaus-Effekt! Sie weiß es nur noch nicht. Zumindest nicht alle und nicht immer. Seit immerhin 2000 ist München mit seinem DIGITALANALOG-Festival aktiv. Seit mindestens 2012, also immerhin gut acht Jahren, rückt auch Nürnberg mit dem DIGITAL FESTIVAL NÜRNBERG die zeitgemäße Fusion von Digital, Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie, Bildung und Kunst stärker ins Bewusststein und kreiert Labore, Projekte und Maßnahmen dazu. Weitere Keimzellen haben sich längst aus ihren Kinderschuhen verabschiedet: In Frankfurt ruft NODEForum for Digital Arts seit 2008 zur Biennale auf. Zürich begann 2015 mit seinem Digital Festival, die DIGITALE Düsseldorf verschreibt sich seit 2016 der Bestandsaufnahme Digitaler Kultur. Nicht alle zielen auf die enge Verknüpfung von Kultur und Digitales ab. Doch die meisten Formate finden selbstreend ihre Verbindungen zu innovativen Kultureinrichtungen und -initiativen. Diese scheinen interessiert, aber auch einer nicht zu übersehenden Trägheit verfallen und vor allem nicht - spezialisiert.
Nicht ohne Grund baut Berlin derzeit an der Förderrichtlinie des Innovationsfonds zur digitalen Entwicklung des Kulturbereichs, führte die Hamburger Kulturbehörde Anfang 2014 ihre eCulture Agenda 2020 ein. Einen bundesweiten Impuls setzt die Bundeskulturstiftung gegenwärtig mit ihrem 18 Millionen Euro schwerden Fonds Digital für den digitalen Wandel in Kulturinstitutionen. Unter anderem mit dem Kultur-Hackathon Coding Da Vinci, aber auch durch die Förderung der Akademie für Theater und Digitalität, einer Initiative des Theater Dortmund. Von digitalen Professionen in Kultureinrichtungen ist die Rede, von deren digitalen Agenten und Agenden und einer Best-Practice-Initiative Richtung digitale Zukunft derselben. Initiativen, Impulse und Veranstaltungen, die das Feld thematisieren und auch konstruktiv bearbeiten, gibt es viele. Das Gespenst der Digitalisierung durchdringt langsam und stetig alle Bereiche unseres Lebens. Auf Fragen wie: Wie können Museen und Theater, Konzert- und Literaturhäuser auf die technologischen Innovationen reagieren? Welche Formen der künstlerischen Produktion, Vermittlung und Kommunikation bringen die Einrichtungen voran? fehlen dennoch erprobte Expertisen. Trotz 40 Jahre Praxis? Offensichtlich reichen die Erfahrungen nicht über das Kurzzeitgedächtnis hinaus. Die Zusammenschau von Kultur und Digital zieht sich wie ein Kaugummi, greift nur fragmentär und muss sich stetig neu erfinden. Der technische Wandel scheint beschleunigt. Die Skepsis groß. Die Rezepte rar. Noch laufen Kunst und Kultur hinterher, erfinden sich nur in Teilen neu. Die Revolution lässt auf sich warten.
Ist der Untersuchungsgegenstand doch weit weniger spannend und aufregend als vielerorts behauptet? Oder fehlen Mittel und Instrumente, der Lage Herr zu werden? Wenn eine namhafte Institution der Kulturpolitik wie die Kulturpolitische Gesellschaft ihre Jahrbuch-Publikation "Digitalisierung und Internet" bereits 2011 veröffentlicht hat und bis auf ein Heft unter dem Titel "Digitalisierung und Kulturpolitik" in 2018 das Thema nahezu liegen lässt, ist das auch eine Aussage. Wo der neue Vorstand doch nur so nach Erneuerung strebt. Wenn Olaf Zimmermann in der gleichnamigen Publikation bereits 2011 untertitelte: "Kulturbereich muss Defensivposten verlassen" und wie folgt resümierte: "Das eigentlich Fatale ist, dass es dem Kulturbereich bislang nicht gelungen ist, diese positiven Entwicklungen herauszustellen und eine eigene positive Geschichte zur Digitalisierung zu erzählen." ist das ein altes, aber scheinbar noch gültiges und sehr nachdenklich stimmendes Statement.
Haben sich zu viele an der Verknüpfung Kultur und Digitales abgearbeitet? War die Zeit noch nicht reif? Hat die Kultur geschlafen, wie vermeintlich die Automobilbranche bezüglich erneuerbarer Energien?
Oder gibt es andere Ursachen dafür, dass eine langjährige Entwicklungsgeschichte, die in der öffentlichen Wahrnehmung und vor allem auch in der Politik derzeit so außergewöhnlich viel Gewicht erhält, starker Positionen und starker Institutionen weitgehend entbehrt und sich so schwer tut, klarere Linien und ein wenig Systematik anzubieten?