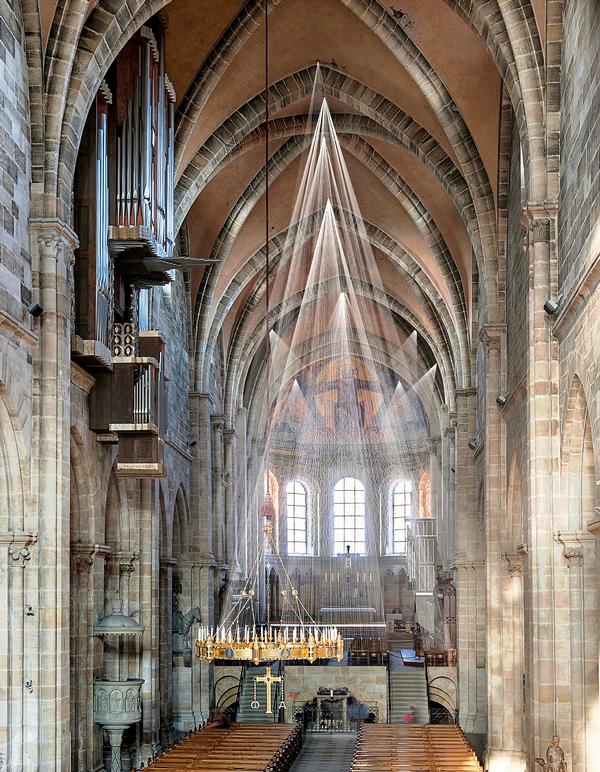Von der herzoglichen Kunst- und Wunderkammer zum Universalmuseum mit internationaler Strahlkraft
Das Universum Friedenstein Gotha
veröffentlicht am 23.09.2024 | Lesezeit: ca. 8 Min.
Gotha ist heute einer der bedeutendsten Museumsstandorte Mitteldeutschlands. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts haben Generationen von Herzögen des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg und Sachsen-Coburg und Gotha hier herausragende kunst-, kultur- und naturhistorische Sammlungen zusammengetragen. Sie sind das Ergebnis der persönlichen Sammelleidenschaft der Gothaer Herzöge und ihres Interesses am Weltwissen ihrer Zeit. Aus der ehemaligen herzoglichen Kunstkammer gingen die heutigen Sammlungen hervor, die zusammengenommen den besonderen Typus des Universalmuseums ausmachen. Im Gegensatz zu den meisten Museen sind Universalmuseen nicht auf ein Thema spezialisiert, wie etwa Gemäldegalerien, historische oder naturhistorische Museen und Technikmuseen.
Die Kunst- und Wunderkammern der Renaissance und des Barocks sind aus den Raritäten- und Kuriositätenkabinetten des Mittelalters entstanden. Wie Bibliotheken waren sie eine Art Wissensspeicher. Mit ihren Sammlungen haben sie den Menschen Zugang zum Wissen über die Welt, über andere Kulturen und über die Natur ermöglicht. Sie präsentierten ein Weltbild, in dem alles miteinander verbunden war.
Den Grundstein zur Sammlung legte Herzog Ernst I. (1601–1675), genannt „der Fromme“, der Erbauer von Schloss Friedenstein. Er richtete die Kunstkammer 1653 in einem großen Saal im zweiten Obergeschoss des Westturms von Schloss Friedenstein ein. Direkt darüber befand sich die Bibliothek und in einem angrenzenden Raum das Komödiengemach, in dem Theater- und Musikstücke dargeboten wurden. Die Objekte waren nach den für Kunstkammern üblichen Hauptgruppen „Artificialia“, „Naturalia“, „Anatomica“ und „Architectonica“ geordnet. Viele der Objekte dieser ersten Kunstkammer auf dem Friedenstein stammten aus der Kunstkammer der Ernestiner in Weimar, sind also deutlich älter als die Kunstkammer selbst.
Durch die nachfolgenden Herzöge veränderte sich der Charakter der Sammlungen und deren Präsentation. Friedrich II. (1676-1732) erweiterte den Bestand der Kunstkammer durch umfangreiche Ankäufe, zum Teil ganzer Sammlungen. 1712 erwarb er die berühmte Münzsammlung des hoch verschuldeten Fürsten Anton Güther II. von Schwarzburg-Arnstadt (1653-1716) für die gewaltige Summe von 100.000 Talern – eine Investition, die sogar die Baukosten von Schloss Friedenstein überstieg. Damit wurde die Gothaer Münzsammlung zu einer der bedeutendsten numismatischen Sammlungen im Europa des 18. Jahrhunderts. Heute ist die Sammlung an Münzen und Medaillen auf Schloss Friedenstein die viertgrößte in Deutschland. Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745-1804) vergrößerte die wissenschaftlichen Sammlungen. Zudem sammelte Ernst II. Gemälde, vornehmlich niederländischer Meister. Durch ihn kamen vier von fünf Ölskizzen des flämischen Malers Peter Paul Rubens (1577–1640) nach Gotha, die zu den Hauptwerken der Niederländersammlung gehören.
Mit Herzog August (1772-1822) übernahm ein leidenschaftlicher Sammler und Künstler die Kunstkammer. Sein großes Interesse an antiken und fremden Kulturen führte zu einer beträchtlichen Vermehrung der bereits vorhandenen Objekte in diesem Bereich. Dazu gehörten vor allem die von dem Orientreisenden Ulrich Jasper Seetzen erworbenen orientalischen Handschriften, Mumien, Sarkophage, Kleinplastiken, Schmuck, Grabbeigaben, Alltagsgegenstände und zahlreiche Naturalien, darunter Mineralien und Fossilien. Die von Seetzen gesandten Ägyptica begründeten in Gotha eine der ältesten Sammlungen ihrer Art in Deutschland.
1824 ließ Friedrich IV. (1774–1825) für ein ausgewähltes Publikum aus den Beständen der Kunstkammer und der umliegenden herzoglichen Schlösser eine Gemäldegalerie im Schloss einrichten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Bestände der ehemaligen herzoglichen Kunstkammer auf Schloss Friedenstein so stark angewachsen, dass eine zusammenhängende Präsentation im Schloss nicht mehr möglich war. Mit dem Tod Friedrich IV. starb 1825 die Linie Sachsen-Gotha-Altenburg aus.
1864 beauftragte der neue Hausherr, Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha, den Wiener Architekten Franz Neumann (1815-1888) mit der Planung und dem Bau des Herzoglichen Museums, das südlich von Schloss Friedenstein auf dem Gelände des ehemaligen herzoglichen Küchengartens entstehen sollte. Das neue Museum bot auf drei Etagen Platz für die Sammlungen des Kunsthandwerks (3.775 Objekte), der „Gemischten Kunst“ (2.215 Objekte), der Antike (3.204 Objekte) und der Grafik (ca. 50.000 Blatt) sowie in großem Umfang der Natur (42.212 Objekte). Allein diese beeindruckenden Zahlen geben Aufschluss über die Fülle an Objekten, die den Besucher:innen zugänglich gemacht wurde. Da das Herzogliche Museum über kein Depot verfügt, wurden alle Sammlungen in Schränken innerhalb der Ausstellung präsentiert bzw. magaziniert. Diese Schränke oder auch Tische waren dabei so konzipiert, dass die Besucher:innen durch verglaste Aufsätze und Türen die Objekte betrachten konnten. Die großzügigen Oberlichtsäle im ersten Obergeschoss dienten der Präsentation der Gemälde. Die fortschrittliche Beleuchtung der Gemälde durch Oberlichter, die die Säle von schräg oben mit Tageslicht erhellten, entsprach den modernsten Gesichtspunkten des klassizistischen Museumsbaus. Die Anordnung der Objekte aus Natur und Kunst, vor allem aber die Hängung der Gemälde galt den Zeitgenossen als vorbildlich.
Die repräsentative Präsentation im Herzoglichen Museum steigerte die öffentliche Wahrnehmung der friedensteinschen Sammlungen nachhaltig. Die Besucherndenzahlen nahmen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges kontinuierlich zu, und mit durchschnittlich 11,5 % war darunter auch eine beachtliche Zahl ausländischer Besucher:innen. Der erste gedruckte „Katalog der Herzoglichen Gemäldegalerie im Herzoglichen Museum zu Gotha“ von Aldenhoven erschien 1890, setzte neue wissenschaftliche Maßstäbe und fand in Fachkreisen weite internationale Verbreitung.
Dieser internationale Ruf sollte den Kunstsammlungen nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch zum Verhängnis werden. In den Wirren nach 1945 wurde Gotha fast vollständig seiner Kunstschätze beraubt. Vor allem die Sowjetunion transportierte einen großen Teil als Entschädigung für die von der deutschen Wehrmacht auf sowjetischem Boden zerstörten und geraubten Kunstwerke.
Das Herzogliche Museum beherbergte nun nur noch die naturwissenschaftlichen Sammlungen. Es wurde 1954 als Biologisches Zentralmuseum wiedereröffnet und 1971 in Museum der Natur Gotha umbenannt. Diese Funktion behielt das Gebäude bis zum Jahr 2010.
Bereits 1958 gab die Sowjetunion einen großen Teil der Kunstsammlungen zurück. Diese wurden jedoch zunächst in Nebenräumen des Schlosses präsentiert oder eingelagert. Erst nach der Sanierung des Herzoglichen Museums zogen die Sammlungen 2013 wieder in das für sie errichtete Museum ein.
Heute präsentiert das Herzogliche Museum die herausragende Sammlung altdeutscher und niederländischer Malerei der Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg sowie ostasiatischer Kunst, erlesene japanische Lackarbeiten, Specksteinfiguren, eine feine Keramiksammlung mit Renaissance-Majoliken, Böttgersteinzeug und Meissener Porzellan. In den beiden Säulenhallen des Erdgeschosses sind die herausragenden Skulpturen von Jean-Antoine Houdon sowie die jährlichen Hauptausstellungen der Stiftung zu sehen. Das Untergeschoss ist der Antike gewidmet und beherbergt die ägyptische Sammlung. Die Ausstellung „Tiere im Turm“ im Westturm von Schloss Friedenstein gibt einen Einblick in die naturhistorischen Sammlungen, im Schlossrundgang selbst sind Highlight Objekte der historischen Kunstkammer zu sehen.
Die Friedenstein Stiftung Gotha (FSG) bewahrt heute rund 1,15 Millionen museale Objekte der Kunst-, Kultur- und Naturgeschichte. Wie in vielen Museen ist nur ein Bruchteil davon zu sehen. Dennoch ist der Anspruch, als Universalmuseum „die Welt im Kleinen“ abzubilden, prägend. Universalmuseen transportieren die Sammlungsidee der Kunstkammer in die Gegenwart. Die Verbindung von Objekten der Antike, der Natur, der Kunst, technischen Innovationen und fremder Kulturen entwickelt auch heute noch eine ganz eigene Stärke zu überraschen und zu erfreuen. Die Bezüge zu heute sind mannigfaltig und können wie ein Augenöffner wirken. Und auch eine andere, nicht zu unterschätzende Qualität hat sich über die Jahrhunderte erhalten: Kunst, Wissenschaft und Unterhaltung gehen in der Kunstkammer wie im Universalmuseum Hand in Hand.
Infos & Termine:
Jahreshauptausstellung „S.O.S. Grünes Herz – Unsere Natur im Wandel“
28. April bis 27. Oktober
Di bis So von 10 - 17 Uhr
An Feiertagen auch montags geöffnet
Friedenstein Stiftung Gotha
Schlossplatz 1
99867 Gotha
service@stiftung-friedenstein.de
www.friedenstein-stiftung.de
Ein lange Vermisster ist zurück!
Eine dieser Skizzen ist erst vor Kurzem auf den Friedenstein zurückgekehrt: „Der Heilige Gregorius von Nazianz“ war nach dem Zweiten Weltkrieg unrechtmäßig aus der Sammlung entnommen worden. Dank der großzügigen Unterstützung durch die Ernst von Siemens Kunststiftung (EvSK) hat die Skizze nun wieder ihren ursprünglichen Platz im Herzoglichen Museum Gotha eingenommen.
Rubens selbst fertigte die Ölskizze im Jahr 1621 an. Sie gehört zur Gothaer Serie von insgesamt fünf um 1620 entstandenen Ölskizzen des Künstlers für die Antwerpener Jesuitenkirche Carolus Borromeus. Den Skizzen kommt eine besondere Bedeutung zu, da die Deckenmalereien mit den ausgeführten Werken aufgrund eines Brandes heute zerstört sind. Die Serie galt als eine der bedeutendsten kunsthistorischen Juwelen der Gothaer Gemäldesammlung und wurde infolge der Kriegsereignisse des Zweiten Weltkriegs in alle Winde zerstreut. Nur zwei der Skizzen befanden sich bis vor Kurzem auf dem Friedenstein.