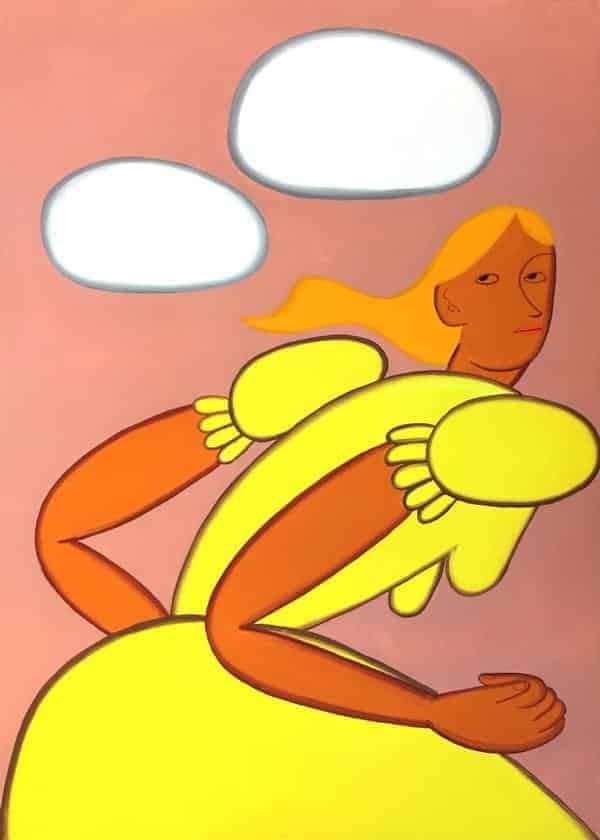Wir haben fertig! Das KunstKulturQuartier als transformativer Meilenstein der Bürger- und Soziokultur
Kulturareale der Welt - Das KunstKulturQuartier Nürnberg
veröffentlicht am 28.09.2023 | Lesezeit: ca. 13 Min. | von Oliver Will
Das heutige KunstKulturQuartier Nürnberg ist ein Haus mit wechselvoller und tiefenscharfer Geschichte. Das zentrale Künstlerhaus, gebaut Anfang des 20. Jahrhunderts, ist seit 2008 das Herzstück des KunstKulturQuartiers und beherbergt unter anderem das Filmhaus, das Kunsthaus und die Kultur Information. In dessen Umfeld, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in wenigen Minuten erreichbar, wurden weitere Häuser angeschlossen. Dazu gehören neben der Kunstvilla, die Kunsthalle und die Tafelhalle sowie der beliebte Open-Air-Spielort Katharinenruine. Letzterer besticht insbesondere durch Konzerte in besonderem Ambiente, auch im Rahmen von Festivalformaten.
Kunsthalle, Kunstvilla und Kunsthaus stehen für sich ergänzende Facetten der Präsentation von zeitgenössischer Kunst. Internationale Gegenwartskunst, regionale künstlerische Positionen seit 1900 sowie Fotografie. Musik, Tanz und Theater finden in der Tafelhalle ihren geeigneten Spielort. Im Filmhaus leuchtet der internationale Film. Gezeigt werden aktuelle Filmkunst, Retrospektiven, thematische Filmreihen, Kinderkino, Stummfilme mit Live-Musik und viele Sonderformate. Die Kultur Information dient als erste Anlaufstelle für Information, Ticketing und Produkte wie Ausstellungskataloge und mehr. In den Offenen Werkstätten ist viel Raum für Reparaturen und kreatives Schaffen.
In drei Bauabschnitten wurde das Haus, begonnen mit dem Mitteltrakt (1996 bis 2000), fortgesetzt mit dem Kopfbau (2000-2002) und schließlich mit dem nördlichen Teil seit 2018 generalsaniert und den Anforderungen nach Möglichkeit schrittweise angepasst. Mit der jüngsten Erneuerung wurden Schallproblematiken im nivellierten Raumprogramm gelöst, indem laustärkeintensive Bereiche und solche, die Ruhe erfordern, zusammengelegt und so voneinander entkoppelt wurden. Zudem wurde der Zielsetzung Rechnung getragen alle Werkstätten auf einer Ebene und über einen Flur zugänglich zu machen. Schließlich diente die bauliche Maßnahme vor allem auch wichtigen Updates im bauordnungsrechtlichen und somit sicherheitstechnischen Sinne. Last but not least wurde ein Lastenaufzug integriert. Die Kosten der jüngsten Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf 30 Millionen Euro, von denen Bund und Freistaat 10,8 Millionen über die Städtebauförderung beisteuern.
Quartiers-Direktor Michael Bader unterscheidet die baulichen Abschnitte und stellt diese in ihren zeitlichen Zusammenhang und inhaltlichen Kontext:
„Die drei Sanierungsabschnitte sind wenig miteinander vergleichbar. Im 1. sanierenden Bauabschnitt 1997 – 2000 wurden die Kriegsschäden nach 1945 behoben. Vor allem im südlichen- und Mittel-Teil. D.h. über 50 Jahre war das Künstlerhaus, das da mehrfach den Namen gewechselt hat, nur in Teilbereichen bespiel- und benutzbar. Bis 1996.
1945 – 1955 als „Americana Club“ diente das Haus zur Unterhaltung für amerikanische Soldaten. Nürnberger kamen da nur rein, wenn sie gute Swing Musiker waren. Davon gab es übrigens viele. Die jungen Thomas Fink oder mein Vater Fritz Bader, Joe Neger oder auch ein Werner Heider – moderiert hat da nicht selten der Conferencier Peter Frankenfeld. Von 1956 – 1960, die Befreier hatten das Haus zurückgegeben, hieß es dann „Gesellschaftshaus“ mit Gaststätte und Saalbetrieb und in einem Galerietrakt wurde die „Städtische Galerie“ untergebracht. Bis 1964 wurden die nutzbaren Räume als „Pädagogische Hochschule“ vermietet. Danach sah es sehr duster um das Haus aus.
1964 – bis ca. 1970 geriet das Künstlerhaus in stadtentwicklungspolitische Turbulenzen. Der junge Kulturreferent Dr. Hermann Glaser plante einen Abriss von Künstlerhaus und Kunsthalle zugunsten einer „KÖMA“, so der Arbeitstitel für einen multifunktionalen Gebäuderiegel.
U.a. der Denkmalschutz verhinderte die Planungen. Dafür entwickelte sich eine Neuausrichtung „bürgernaher Kulturarbeit“, forderte Glaser programmatisch ein „Bürgerrecht Kultur“ in der demokratischen Gesellschaft ein. Um den aus seiner Sicht gegängelten Jugendlichen mehr Freiraum zu geben, war er 1973 ein Mitbegründer des selbst verwalteten Nürnberger Jugendzentrums.
1973 – 1996 war dann – zwar immer wieder von Unterbrechungen, vom Scheitern und Schließen begleitet – die große Zeit der Selbstverwaltung. Das KOMM drückte dem Künstlerhaus seinen Stempel auf. In aller Vielschichtig- und Widersprüchlichkeit.
Aber erst dann, 1996!, begann die Sanierung des Hauses, das mittlerweile nur noch unter größten Mühen und Kompromissen einen betriebs- und genehmigungsfähigen, für Veranstaltungen und öffentliche Nutzung erlaubten Zustand vorweisen konnte.
Als 1996 das Künstlerhaus unter dem Namen K4 (stand für Kultur- und Kommunikationszentrum im Künstlerhaus am Königstor) in städtische Trägerschaft kam, begannen die professionellen Sanierungsarbeiten. Zuerst eben die Behebung der Kriegsschäden im „Mittelschiff“, dann (bis 2000) Abriss und Neubau des südlichen, totalzerstörten Vorbaus. Statt der im 2. Weltkrieg zerstörten Türmchen, ein Kubus aus Stahl und Glas, architektonisch höchst umstritten.“
Ob das Haus nach nun knapp 30 Jahren Sanierung in verschiedenen Abschnitten und Anpassungen einer neuen Ära engegensieht und ob es heute so da steht, wie seine Akteure und die Zentralverwaltung es wollten oder bleibende Defizite benannt werden müssten, beantwortet Bader wie folgt:
„Letztlich zerbröselte uns der nördliche, größte Teil des langgezogenen Kulturtankers zwischen den Fingern, waren TÜV oder BoB nicht mehr weiter mit Kompromissen zufriedenzuzustellen. Auch die „Bestandsgarantie“ half da nicht weiter. Jetzt haben wir ein (veranstaltungs-)technisch gut ausgestattetes Gebäude, das dem Standard eines Veranstaltungshauses gerecht wird. Keine „goldenen Wasserhähne“, kein rausgeweißeltes, steriles Haus – Architekt Prof. Florian Nagler (München) wollte ALLE Spuren der Vergangenheit sichtbar lassen. Graffitis und Aufkleber, unterschiedlichste Materialien, die teils krass nebeneinanderstehen – es sollte ja der Charme dieses Hauses erhalten bleiben. Und funktionaler gestaltet. In einer tief unter der Erde liegenden „Clubzone“ kann es laut werden, ohne dass man bei einer Lesung im 1. Stock sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Endlich können alle Räume und auch der weitläufige Garten barrierefrei erreicht werden. Und – ganz wichtig – alle zig, zum großen Teil ehrenamtliche Gruppen und Vereine und Werkstätten finden wieder ihren Platz. In neu gestalteten, technisch überholten Werkstatt-, Seminar- und Veranstaltungsräumen.
Es wurde gebaut wie geplant. Dass auf dieser langen Strecke Kompromisse eingegangen und Lösungen gefunden werden mussten, ist mehr als verständlich. Überlegen Sie mal: wir haben zu bauen begonnen, als die Materialkosten im Baugewerbe gerade durch die Decke gegangen waren, dann die Pandemie, dann Krieg in Europa – alle Lieferketten brechen zusammen und jetzt Inflation!
Da muss einiges auf der Strecke bleiben. Da müssen im Detail Abstriche gemacht werden. Im Großen und Ganzen ist aber alles Wesentliche verwirklicht worden.“
Das KunstKulturQuartier ist in erster Linie die dezentrale räumliche Zentrale für diskursive, partizipatorische Kulturarbeit und Ermöglichungsareal für Labore, Experimente und kreatives Werken. Sein Raumangebot bietet Flächen für Ausstellungen, Performances, Konzerte, Partys, Gastronomie, Café, Tagungsräume, Werkstätten und einen angeschlossenen Biergarten. Die Multifunktionalität unter einem Dach motiviert selbstredend zu interdisziplinären oder Disziplin übergreifenden Formaten im Zuge der Kooperation der unterschiedlichen Akteure.
Im Unterschied zu vielen der heutigen großen Kulturareale, die mehrere Institutionen unter einem Dach vereinen und die baulich erst in jüngerer Vergangenheit, sozusagen am Reißbrett kreiert wurden, ist in Nürnberg die historisch gewachsene Situation prägend und ganz offensichtlich unter seinen ganz eigenen Artenschutz gestellt. Die Rolle des KunstKulturQuartiers als Moderator, räumlicher Ermöglicher und Kooperateur scheint durchgreifender und offener. Jenseits der eigenen Programmatik stärkt das KunstKulturQuartier das Schaffen der externen Kulturschaffenden auf besondere Weise. Der Geist des einstigen „Kommunikationszentrums von unten“ steckt tief in den Mauern und trifft nicht nur auf organisatorische Unterstützung, sondern auf eine zentrale Anlaufstelle als Produktions- wie Präsentationsstandort. Bisweilen sicherlich auch als Reibungsfläche, die für einen gesunden Kulturbetrieb nur dienlich sein kann. Beim Blick von außen lässt das eine vorzeigbare Durchlässigkeit vermuten oder zumindest das entsprechende Potenzial dazu verorten. Nürnberger Kulturschaffende haben so eine sichtbare und potente Anlaufstelle. Für Besucher:innen entsteht ein breites, sich gegenseitig befruchtendes Angebot, das auf diese gebündelte Weise Wirkungskreis und Anziehungskraft der Einrichtung deutlich erhöht und weit über eine rein konsumtive Produktpalette hinauswächst. Die thematische Gestaltung innerhalb der Programmatik vergrößert die Möglichkeiten aller. Der Verteilungskampf wird, wenngleich nicht obsolet, solidarischer und stärker. Die Ausführungen des Leiters des KunstKulturQuartiers unterstreichen dies:
Die Eröffnungssaison läuft bereits. Wir machen nach und nach alles auf, was fertig ist. So einfach und so kompliziert. Die Glas- und Textilwerkstätten sind bereits seit Frühsommer in Betrieb, der Quartier-Garten öffnete zur „Blauen Nacht“; der WWN (Werkbund Werkstatt Nürnberg) beginnt zu Schulbeginn mit dem ersten Semester. Ende September wird NIHRFF, das internationale Filmfestival der Menschenrechte, erste Filme im Festsaal zeigen, Nürnberg Pop kommt mit ersten Konzerten ins Haus, „Blues will eat…“, das traditionsreiche Bluesfestival, und im Kunsthaus (gemeinsam mit der Kunsthalle Nürnberg) geht es mit neuem Eingang und Foyer in die Ausstellung „Who’s afraid of Stardust – Positionen queerer Gegenwartskunst“.
Das Museumsquartier in Wien – mit dem Tanzquartier im Museumsquartier hatte ich viel zu tun – lässt sich mit dem KunstKulturQuartier, nicht mit dem Künstlerhaus als solchen vergleichen. Hinsichtlich genreübergreifender, interdisziplinär vernetzter Sparten. Das LAC in Lugano verbindet bildende und darstellende Künste in einer großartigen Art und Weise. Beide Institutionen haben jedoch entscheidend andere Genesen und konkrete Zielrichtungen.
Das Künstlerhaus dagegen hatte eigentlich nur bei der – übrigens maßgeblich von der Bürgerschaft initiierten und finanzierten – Gründung ein Konzept. Seit den 70er Jahren spätestens eroberte die Stadtgesellschaft, also daraus Initiativen, Kollektive, Aktivisten, Gruppen und Vereine, Verbände das Haus. Mal mehr, mal weniger – in Selbst- oder in kommunaler Verantwortung. Da drückten sich Bedürfnisse der Bürger:innen aus, enstanden „Offene Werkstätten“, gründeten sich Parteien (Bündnis 90 / Die Grünen), das Stadtmagazin „plärrer“, ein Fahrradkurier, die Medienwerkstatt, probierten sich Veranstalter:innen in ersten großen Konzerten aus, aus denen große Konzertagenturen entstanden, zog eine „Kultur von Unten“ durchs Haus an die Öffentlichkeit und erweckte Aufmerksamkeit für andere Lebensmodelle, für kulturelle Teilhabe, für politische Gegenentwürfe. Das Künstlerhaus begann, die Diversität, die Interkulturalität der Gesellschaft abzubilden. So ist es bis heute geblieben, nur, dass die Nische „Soziokultur“ längst keine Nische mehr ist, sondern die Breite der Kultur eingenommen hat. „Kultur im Zentrum“ heißt dann auch der zweideutige Slogan, den sich das Künstlerhaus zur Wiedereröffnung gegeben hat.“
Die zum großen Teil ehrenamtlich agierenden Gruppen, Vereine und Verbände spielen die Hauptrolle im Künstlerhaus. Das Miteinander von Laien und Profis, städtischer und privater Trägerschaft, die sogenannte „Freie Szene“ ist die große Herausforderung.
Musikverein und Kaffee Kaya, die Offenen Werkstätten, der WWN, das Filmhaus, die großen Filmfestivals NIHRFF und Filmfestival Türkei Deutschland, das Kunsthaus (u.a. Quartier für regelmäßige Ausstellungen des BBK), ab Herbst neu die „Gentlemachine“ und den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und viele weitere Initiatven. Sie stehen in unterschiedlichen Verhältnissen zum Betreiber „Stadt“, mieten und pachten, in Kooperation, in komplett eigener Trägerschaft. Auf der einen Seite sind es Akteur:innen, die noch aus der KOMM-Zeit stammen, andere sind erst mit dem K4 entstanden und – so viel Wandel war nie! – werden wohl bald anklopfen und Bedarf und Bedürfnisse anmelden.
Der 3. Bauabschnitt hat das Haus für die nächste Zukunft aufgestellt, baulich, technisch vielleicht für die nächsten 30 Jahre. Wir übergeben jetzt das Haus in diesem Zustand wieder der Stadtgesellschaft. An ihr ist es jetzt, etwas daraus zu machen, es zu prägen und weiter zu entwickeln, wie die Generationen davor.“
Ohne Personal und Kernverwaltung beträgt der Jahresetat des Künstlerhauses ca. 250.000 €. Es finden 2.000 Veranstaltungen jährlich statt, bei denen 180.000 Besuchende zu zählen sind. Das Haus hat zehn angestellte Mitarbeiter, Auszubildende und Praktikanten sowie geringfügig Beschäftigte und (wechselnde) ehrenamtliche Mitarbeitende.
Das „Kulturareal“ KunstKulturQuartier, das wird bei näherer Betrachtung deutlich, nimmt eine Sonderstellung im Reigen der Kulturareale ein. Solide gestützt, programmatisch offen und dynamisch. Ein Areal mit mehreren Häusern, polyzentrisch quasi, auf deren Säulen das Gesamtquartier steht. Mit strahlender Lebendigkeit im Mix aus städtischem Hauptamt und privatem Engagement. Auf Augenhöhe mit den großen Spielern der Nürnberger Kulturlandschaft.