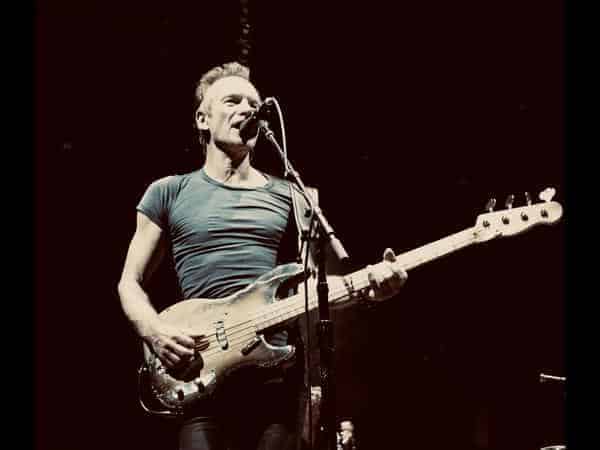Open Air: Frei unter freiem Himmel?
Von der Faszination und der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Kulturerlebens draußen
veröffentlicht am 30.05.2023 | Lesezeit: ca. 17 Min. | von Friederike Engel
Religiöse Rituale unter freiem Himmel waren einst die Wiege des okzidentalischen Theaters – zwischen transzendentaler Erfahrung, Rausch und Gemeinschaftserlebnis. Noch heute können die akustisch meisterhaft konstruierten Amphitheater bewundert werden, in denen im antiken Griechenland während der Dionysien die Kunst gefeiert wurde. Auch nach der Antike, zu Zeiten des Mittelalters fand mit fahrenden Theatertruppen und Musikanten das künstlerische Leben vor allem draußen statt – ausgenommen, es war in einen kirchlichen Kontext eingebunden. Mit dem Erstarken der Hofkulturen in Europa wurden Theater und Musik verstärkt in den Dienst der Adelssitze gestellt und das demokratische Draußen wich dem aristokratischen Saal, dem Salon, der repräsentativen Bühne. Ausnahmen gab es selbstverständlich zu jeder Zeit, aber die Institutionalisierung der Künste an bestimmten Orten, zu denen nicht alle Menschen Zugang hatten, schritt voran. Zwar öffnete sich mit der Etablierung des bürgerlichen Milieus im ausgehenden 18. Jahrhundert der enge Kreis der aristokratischen Kulturelite, aber es gab noch immer viele, die von Kunst und Kultur ausgeschlossen waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann vermehrt das Bestreben, die Teilhabe zu vergrößern, andere Orte zu bespielen. 1920 beispielsweise begründete Max Reinhardt mit dem „Jedermann“ auf dem Domplatz mitten in der Stadt die Salzburger Festspiele, bis heute eine der traditionsreichsten Freilichtveranstaltungen Europas. Dass 103 Jahre später ein Ticket um die 200 EUR kosten und sich eine elitäre Kulturtourismus-Blase um das Ereignis scharen würde, konnte er nicht ahnen. Der Erlös der ersten Vorstellung kam den Kriegsinvaliden zugute und der Darsteller des Teufels bekam der Legende nach als Gage eine Lederhose. Trotz solcher Initiativen der Öffnung waren noch immer viele ausgeschlossen. Außerdem umgaben zu viele Verhaltenskodizes die Kultursphäre und erschwerten den Zugang. Eine wirkliche Veränderung und interessanterweise auch die Geburtsstunde des Open Airs, wie wir es heute zunächst assoziieren, schaffte erst die in den 60ern einsetzende Pop- und Massenkultur. Stichwort: Woodstock. Freier Himmel, freie Liebe, freies Leben – dafür standen Open-Air-Konzerte fortan. Hier konnten die Haare so lang sein wie sie wollten, kein Schlips und kein Kragen störte und die Nächte waren nicht zum Schlafen da. Open Air wurde ein Ausdruck rebellischer Jugendkultur, die sich gegen das Establishment auflehnt.
Heute gehören Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel in verschiedensten Spielarten zum gesellschaftlichen Leben, ob kommerziell oder subventioniert, ob an speziellen Orten oder auf dem freien Feld, ob Musik, Theater oder bildende Kunst. Ein Freiheitsversprechen und die Verheißung eines Gemeinschaftserlebnisses der besonderen Art schwingen bei diesen Veranstaltungen immer mit. Gerade die Zeit der Pandemie hat Fluch und Segen des Kulturerlebens unter freiem Himmel offengelegt. War in den letzten drei Jahren das Draußen aufgrund seiner geringen Aerosolbelastung oft die einzige Möglichkeit überhaupt live Kultur zu erleben, sind auch Vorbehalte gegenüber Massenveranstaltungen lauter geworden. Was versprechen wir uns von Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel, was ist ihr gesellschaftliches Potenzial im Hier und Jetzt und in der Zukunft? Blicken wir aus verschiedenen Perspektiven auf unterschiedliche Open-Air-Formate in der Region.
Kultur vereint mit Natur
Sie sind älter als die großen Pop- und Rockkonzerte im Freien, die Kreuzgangspiele Feuchtwangen. Schon 1949 gingen sie das erste Mal über die Bühne. Sie sind ein Prototyp für Freilichttheater, wie es viele kleine Orte in Franken temporär oder dauerhaft anbieten, von den Calderón-Festspielen in Bamberg bis zur Luisenburg in Wunsiedel. In Feuchtwangen wird im romantischen Kreuzgang eines ehemaligen Benediktinerklosters gespielt. 511 Zuschauer:innen finden hier Platz und in der Saison werden Rund 150 Vorstellungen angeboten. Dr. Maria Wüstenhagen, Leiterin des Kulturamts der Stadt Feuchtwangen und Dramaturgin der Kreuzgangspiele ist sich sicher, „der Zauber für die Besuchenden liegt vor allem im Zusammenspiel von Theater und Natur“, denn selbstverständlich arbeiten die Freilichtspiele mit den natürlichen Lichtverhältnissen und dem Ort an sich, „wenn dann an einer besonders tragischen Stelle im Stück, eine dramatische Wolkenkulisse am Abendhimmel aufzieht, man nach der ergreifenden Liebesszene in den Sternenhimmel gucken kann oder, wie bei einer Dracula-Vorstellung einmal passiert, Fledermäuse über den Zuschauern kreisen, dann ist dies ein besonderes Erlebnis.“ Auf manches muss allerdings im Umkehrschluss beim Freilicht verzichtet werden, denn ein ausgefeiltes Lichtkonzept greift natürlich nur bei Dunkelheit und es gibt selten ein Bühnenbild zu bestaunen, „dafür ist alles absolut natürlich, wirklich bepflanzt und somit sehr material- und ressourcenschonend orientiert“, sagt die Dramaturgin im Brustton der Überzeugung. „Natürlich kann man hier nicht alles behaupten, denn der Kreuzgang spielt immer mit und darauf sollte man bei der Stückauswahl auch achten. Mit ‚Luther‘ hatten wir beispielsweise die perfekte Situation in einem ehemaligen Benediktinerkloster, bei so etwas wie ‚Cabaret‘ ist es schwieriger, da wäre die Freiheit einer Blackbox vielleicht einfacher. Dafür erlebt man hier Theater in einer Umgebung, die es nur ein Mal gibt – im Falle der Kreuzgangspiele die natürlich umwachsenen Arkaden einer alten Klosteranlage!“, schwärmt Wüstenhagen. Den großen Zuspruch des Publikums erklärt sie sich weiterhin vor allem über den niederschwelligen Zugang: „Die Kleidung für einen Besuch im Freilichttheater wird beispielsweise vom Wetter vorgegeben, da muss man nichts repräsentieren und nirgends hineinpassen“. Das Wetter ist Dreh- und Angelpunkt des Open-Airs und es potenziert die Einmaligkeit des Theatererlebnisses sogar. Um dies zu veranschaulichen, erinnert sich die Dramaturgin am liebsten an eine Vorstellung von „Geierwally“ an einem sehr regnerischen Abend: „Alle im Publikum hatten die weißen, glänzenden Regenponchos an, die am Eingang verteilt werden und auf der Bühne wurde eine Berg- und Gletscherlandschaft poetisch beschrieben. In diesem Moment wurde der Zuschauerraum zu dieser Landschaft und alles ist auf schönste Weise miteinander verschmolzen.“ Generell stellt Frau Dr. Wüstenhagen fest, „scheinen für Beteiligte und Publikum meist die Vorstellungen bei schlechtem Wetter am eindrucksvollsten zu sein, denn hier werden alle wirklich zu einer Gemeinschaft, einer Schicksalsgemeinschaft.“ Eine Erfahrung, die vermutlich auch so mancher Fan von Rock im Park in Nürnberg kennt, dem Prototyp des Open-Air-Musikfestivals, wie es vielen sofort in den Sinn kommt.
Die Grenzen spüren
Jedes Jahr um Pfingsten herum pilgern Zehntausende musikbegeisterte Jugendliche, junge und auch nicht mehr ganz junge Erwachsene, denn die sind inzwischen ja auch mit dieser Art Festivals großgeworden, zum Festivalgelände am Nürnberger Dutzendteich. Mit großen Campingausrüstungen, Vorräten und jeder Menge Feierlaune werden die Grünflächen besiedelt. Was die Lust am Festivalbesuch ausmacht, daran erinnert sich Anna Schwarm, Leiterin des Nürnberger Künstlerhauses, Kennerin von Subkultur und Musikszene, die seit ihren ersten Besuchen als Teenagerin in den 90ern dabei ist: „Zuallererst war es ein Versprechen von Abenteuer und einer großen, bis dahin nicht gekannten Freiheit: drei Tage unterwegs mit guten Freunden, ohne Eltern, Campen, Party, gemeinsam die Nacht durchmachen, neue gleichgesinnte Menschen kennenlernen, Bands live erleben, für die man brennt und vor allem ganz nah dran sein an der Musik.“, schwärmt die heute 44-Jährige. Sie hat in ihrem Leben eigentlich fast kein großes Open Air ausgelassen vom Wave-Gothic-Treffen bis zum Mera-Luna und vom Summerbreeze bis Wacken und auch im Ausland beim Sziget Festival in Budapest und anderen ist sie gewesen. „Ein bisschen hat ein Festival auch immer mit Grenzerfahrung und sich dabei anders spüren zu tun. Man geht ganz sicher auch mal an sein körperliches Limit: die einen mit Alkohol und Party, die anderen mit durchtanzten Tagen und durchwachten Nächten. Viele wahrscheinlich alles auf einmal und zugleich. Dabei entsteht vermutlich ein ähnliches Hochgefühl wie bei jemandem, der intensiv Klettern geht oder einen Marathon läuft“, erklärt sich Schwarm die hohe Bereitschaft überall hinzufahren und viel Eintritt zu bezahlen. Hochgefühle und Adrenalin, egal ob Sonne oder Matsch, „wenn Du heimkommst, spürst Du in jedem Knochen, dass Du was erlebt hast, Du hast neue Freunde und einen erweiterten Horizont“ und wie im Fall von Anna Schwarm vielleicht auch noch den Mann fürs Leben gefunden: „Wir trafen uns bei Rock im Park 2008 bei einem Hagelschauer unterm Bierstand an der Alternastage. Gemeinsam sahen wir uns Bad Religion an und teilten uns eine Zigarette. Nach meinem Feierabend, ich war als Berichterstatterin für die dpa da, haben wir uns bei Rage against the machine wiedergetroffen und bei Metallica zum ersten Mal geküsst. Inzwischen sind wir 15 Jahre zusammen, sieben Jahre verheiratet, haben einen kleinen Sohn und ich bin Nichtraucherin. Aber Festivals und Konzerte gehören für uns immer noch dazu.“
Adrenalin spielt auf den Großveranstaltungen nicht nur bei den Besuchenden eine Rolle: „Open Airs sind sicherheitstechnisch eine große Herausforderung, weil es teilweise um richtig viele Menschen geht und weil die Naturgewalten ungehindert Zugriff auf die Veranstaltung haben“, gibt Frank Schmidt, Technischer Leiter des Max-Morlock-Stadions, zu bedenken. „Das Worst-Case-Szenario ist die Räumung eines Geländes, auf dem sich mehrere Tausend Menschen aufhalten. Bei Rock im Park hatten wir bereits Räumungen wegen Unwetter. Hat aber alles ganz gut funktioniert.“ Generell ist der erfahrene Veranstaltungsmeister zuversichtlich: „Großveranstaltungen haben sich insgesamt sicherheitstechnisch verändert, weil wir uns heute wesentlich mehr Gedanken über Sicherheitsbelange machen als früher. Heutzutage gibt es bei großen Festivals ausgebildete Krisenkommunikatoren, ausfallsichere Durchsageanlagen im Campingbereich und Mitarbeiter, die sich mit nichts anderem als Arbeitssicherheit beschäftigen. Das war vor 20 Jahren nicht mal im Gespräch. Das Bewusstsein ist also ein ganz anderes geworden.“
Trotz dieser eigentlich positiven Entwicklungen in Sicherheitsbelangen, verändert sich der Blick auf Musikfestivals dieser Art und Größe. „Ob man will oder nicht, bekommt man einen kritischeren Blick: sei es der Alkoholmissbrauch und vielleicht auch anderes mehr, übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen im Rausch, seien es die gigantischen Müllberge, die innerhalb weniger Stunden entstehen. Ich habe allerdings auch früher noch nie verstanden, was Leute auf Musik-Festivals zieht, die sich einfach nur am Campingplatz druckbetanken, an drei Tagen keine einzige Band sehen und am Ende Zelt und Grill einfach stehen lassen nach dem Motto: nach mir die Sintflut. Die machen mich fast ein bisschen ärgerlich. Deswegen meide ich zunehmend die großen Festivals, die kommerziell natürlich auch auf genau dieses Publikum angewiesen sind.“ Mit „kommerziell“ liefert Schwarm ein entscheidendes Stichwort. Ein normales Ticket ohne VIP-Aufschlag und Sonderrechte liegt zwischen ca. 300 EUR für das gesamte Wochenende und ca. 100 für den einzelnen Festivaltag. Zwar ist das Lineup wirklich erstklassig und viele Bands, die Rang und Namen haben, kommen jährlich auf das Nürnberger Zeppelinfeld. Eine Teilnahme bleibt dennoch eine Investition. Und mit dem Eintrittspreis steigt vermutlich auch die Erwartungshaltung. An diesem teuren Wochenende muss einfach alles großartig und außergewöhnlich sein, auch wenn die eigene Freiheit dann an die Grenzen der Freiheit anderer stoßen mag.
Umsonst und draußen
Ein Open Air nicht als abgezäunte Party der Glückseeligen, die dafür teuer bezahlen, sondern eine Kulturerfahrung für die Allgemeinheit zu bieten, ist schon lange Ziel der Stadt Nürnberg, die sich mit ihren Großveranstaltungen von der Blauen Nacht über das Klassik Open Air bis hin zum Bardentreffen längst einen Namen gemacht hat. Reiner Sikora war als Leiter des Projektbüros lange für diese Veranstaltungen in der Frankenmetropole zuständig. Im Jahr 2000 hat er das Klassik Open Air aus der Taufe gehoben. Die Idee hierfür entstand allerdings schon viel früher, bei einem USA Besuch von dem Sikora berichtet: „Als junger Mann durfte ich in den 80ern ein klassisches Konzert im New Yorker Central Park erleben. Hier wurden regelmäßig kostenlose Konzerte für die gesamte Stadtgesellschaft veranstaltet. Ich erinnere mich an die unglaubliche Stille, das entspannte Zuhören und die friedliche Atmosphäre auf der Wiese inmitten der Großstadthektik.“ In Europa und Deutschland gab es solche Konzertformate zu dieser Zeit noch kaum, dabei ist gerade der Auftritt eines philharmonischen Orchesters jenseits von Konzertsaal und Graben wirklich ein Geniestreich der kulturellen Öffnung. Dass es im Jahr 2000 in Nürnberg dann dazu kommen konnte, hatte Sikora zufolge mit der Gunst der Stunde zu tun, denn die Stadt feierte ihr 950-jähriges Bestehen und hierfür waren schlicht andere Summen abrufbar. „Man muss sich ja nur mal vorstellen, was allein eine passend ausgestattete Bühne für 150 Musiker kostet und das war damals schon teuer“. Dank der Jubiläumsgelder ging das erste Klassik Open Air also zum Stadtgeburtstag über die Bühne. „Das Ganze ist recht zaghaft angelaufen. Das Wetter war in diesem Jahr eher durchwachsen und es kamen so rund 10.000 Menschen in den Luitpoldhain. Aber die Faszination und das Potenzial für Kunst und Kultur wurden schon deutlich.“ Das Format blieb nach dem Jubiläums-Testlauf also bestehen und das Konzept wurde weiterentwickelt. „Im Londoner Hyde Park habe ich bei einem ähnlichen Konzert die britische Tradition des Picknickens erleben dürfen und habe beschlossen, das unbedingt ins Nürnberger Klassik Open Air zu integrieren. Wir haben die Leute daraufhin also aufgefordert, ihre Picknicksachen mitzubringen. Und tatsächlich, es kamen ganze Großfamilien und Freundesgruppen mit Decken, Campingausrüstung und allerhand Köstlichkeiten oft schon am Nachmittag. Dann wurden den ganzen Tag Gesellschaft und Essen genossen und am Abend als schöner Abschluss dem Konzert gelauscht“, erinnert sich Sikora. Bei einem Besuch der Potsdamer Schlössernacht hat er dann noch die Wunderkerzenaktion entdeckt und nach Nürnberg importiert: „Das ist schon immer ein beeindruckendes Bild, diese volle Wiese, auf der dann alle nach und nach die Sternlespeier, wie wir hier in Franken sagen, anzünden und ein gigantisches Lichtermeer entsteht.“ Sikora ist sich sicher, dass solche Momente auch ein Stück weit Gemeinschaft schaffen. Einen Beweis hierfür liefert für ihn das umsichtige Verhalten des Publikums über die Jahre: „Da hat wirklich immer eine Ansage der Moderation am Ende des Konzertes gereicht und die Wiese war anschließend picobello. Jeder hat seinen Müll weggeräumt!“, berichtet er, noch immer ein wenig erstaunt. Doch der Lauf der Zeit macht auch vor gelungenen Klassik Open Airs keinen Halt, sie verändern sich. „Und so sehr man sich auch über den Zuspruch freuen konnte, es wurden einfach immer mehr Menschen“, klagt Sikora. „Aufgrund des Andrangs musste irgendwann die Picknick-Idee aufgegeben werden und die Leute müssen heute fast wie in einem Konzertsaal in Reihen sitzen. Auch die Absprachen mit den Ordnungsbehörden wurden immer schwieriger, Sicherheitsabsperrungen wurden eingefordert, die noch mehr von der offenen, friedlichen Atmosphäre weggenommen hätten. Man konnte glücklicherweise vieles wegargumentieren, aber, was die Zukunft bringt?“ Grundsätzlich liegt es Reiner Sikora, heute nach 37 Jahren Kulturarbeit im Ruhestand, am Herzen, dass solche Formate weiterbestehen. „Aber man darf nicht zu viele Abstriche bezüglich der Atmosphäre machen und keinesfalls Eintritt verlangen.“ Genau dieser Forderung ist schwer nachzukommen, denn Veranstaltungen dieser Art werden immer teurer, die Massen als Zugpferd und die Umwegrentabilität als Schlüsselargument scheinen zur Sponsorenbindung und -akquise unverzichtbar. Dabei liegt genau hier die Gefahr: „Ich habe mich lange dafür eingesetzt, nicht überregional und international für das Nürnberger Klassik Open Air als größtes seiner Art in Europa mit jährlich über 80.000 Besuchenden zu werben. Denn: Warum müssen hierfür auch noch Menschen aus der ganzen Welt anreisen? Es ist für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gedacht. Mit immer mehr Besuchenden wird es verlieren – das war auch schon beim Bardentreffen so, als es mit seiner Hauptbühne vom Burggraben auf den Hauptmarkt ziehen musste. Das Stadtmarketing und die Politik haben das immer anders gesehen. Ist ja irgendwie auch verständlich, aber wirklich schade.“
In der Zukunft kleiner und immersiver?
Hat die Kultur der Großevents ihren Zenit überschritten? Zwar werden jährlich ähnliche Zahlen gemeldet, aber die Zeiten des Wachstums und der Superlative scheinen vorüber. Viele Veranstaltungen, die einst frei zugänglich, friedlich und entspannt waren, wurden in den letzten Jahren heillos überlaufen – hierzu zählen auch Kirchweihen und Bierfeste, die vom Tagestourismus regelmäßig überrollt werden. Mit der eigentlichen Idee, den öffentlichen Raum vor allem für die Menschen vor Ort mit Kultur zu beleben, hat das in vielen Fällen nichts mehr zu tun. Dabei bleibt das ein wertvolles Ziel für eine demokratische Gesellschaft. Corona hat gezeigt, wie wichtig dieser Raum der zwanglosen Begegnung mit Kunst und Kultur ist, gleichzeitig aber auch die Grenzen von Open-Air-Veranstaltungen aufscheinen lassen. Während Freilichttheater wie die Kreuzgangspiele eher punkten können, stellen die fortschreitenden Debatten um Nachhaltigkeit Großevents mit zugehörigem Veranstaltungstourismus massiv infrage. Die Zukunft wird einen anderen Umgang mit Kultur im öffentlichen Raum erfordern. Vielleicht liegt in der verstetigten Nutzung, in kleineren, immersivere Formaten der Schlüssel? Viele der angesprochenen Veranstaltungen leben ja noch immer von der Stilisierung zum Event, das den einen besonderen Tag, die eine unvergessliche Nacht, das eine unbeschreibliche Wochenende verspricht. Wenn Kunst und Kultur aber kostenfrei immer wieder im Alltag der Menschen auftauchen, einen die Nürnberger Philharmoniker zum Beispiel mit einem Konzert auf dem Kornmarkt überraschen würden, wie wäre das? Dieser Gedanke scheint naiv, ist aber vielleicht notwendig. Tainá Roma ist Masterstudierende der Theaterwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Ihr Forschungsschwerpunkt: Theater im öffentlichen Raum. Sie selbst ist ausgebildete Schauspielerin und Theaterpädagogin aus Brasilien, das eine lebendige Straßentheaterkultur hat. Für sie hat die Arbeit auf der Straße großes Potenzial, das leider viel zu schlecht gefördert wird. „Das Straßentheater ermöglicht es, ein sehr breites Spektrum von Besuchenden zu erreichen, die sich hier nicht nur in einzelnen Geschichten, sondern Kunst und Theater als Teil des eigenen Alltags erkennen können. Die Straßen in Deutschland sind voller Leben und Vielfalt, und das Theater sollte in diesem Raum voller reicher Narrative stärker präsent sein.“ Für sie ist eine Demokratisierung des Kulturerlebens mittels Straßentheaters Herzensangelegenheit. Ob der vielbeschworene Weg vom Umsonst-und-Draußen-Format zum Besuch von Kulturinstitutionen tatsächlich funktioniert, sei dahingestellt. Die Zahlen belegen es bisher nicht, dennoch kommt es wohl auf weitere Versuche an. Eine Gemeinschaft braucht gemeinsame Kunst- und Kulturerlebnisse, niederschwellig und ja, draußen, im ureigenen öffentlichen Raum. Dass Freiheit dabei immer auch Grenzen hat, muss genau hier vielleicht immer wieder aufs Neue erfahren und verhandelt werden, wie es ein demokratisches Miteinander eben verlangt. Hoffentlich spielt das Wetter mit!